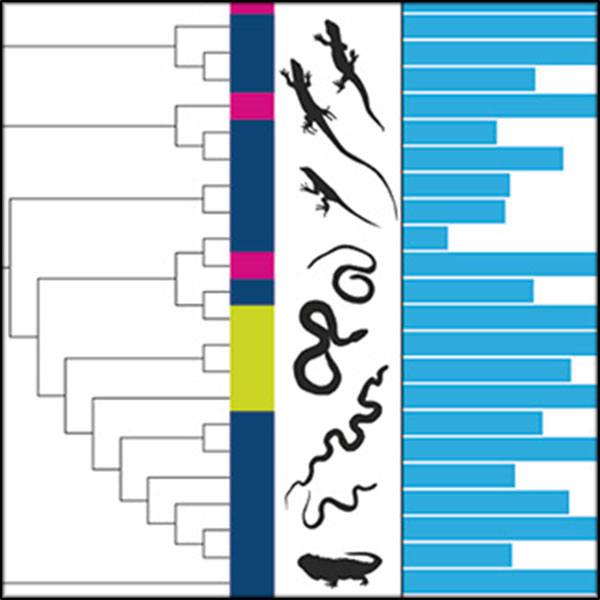Fokus: Publizieren im Umbruch
Wer zuerst veröffentlicht, hat gewonnen
Möglichst viel und rasch zu publizieren ist in der Wissenschaft heute das Mass aller Dinge. Wie es zur grossen Bedeutung der Fachartikel kam.

Mit Erschrecken sieht der Postdoc, dass eine Konkurrentin fast genau das publiziert hat, was er veröffentlichen wollte. Und das sogar besser abgestützt als bei ihm. Neid und Wut übermannen ihn. | Illustration: Melk Thalmann
Im einzigen privaten Brief von Isaac Newton an Gottfried Wilhelm Leibniz deutet nichts auf eine spätere Schlammschlacht hin. Newton, Entdecker der Schwerkraft, beteuert darin im Oktober 1693, dass er «Freunde höher einschätze als mathematische Erfindungen» und dass er ihm, Leibniz, «ein unwandelbarster Freund» sei. Bald darauf aber entzündet sich der vielleicht berühmteste und hässlichste Prioritätenstreit der Geschichte.
Die Gefolgschaft Newtons wirft dem deutschen Mathematiker und Philosophen Leibniz vor, er habe wesentliche Elemente seiner 1684 veröffentlichten Infinitesimalrechnung von Newton gestohlen. Das führt zu einer Plagiatsklage, die 1712 von einer Kommission der Royal Society untersucht wird. Die Kommission, von Newton zusammengesetzt und gelenkt, spricht Leibniz schuldig und schliesst ihn kurz darauf aus der Gesellschaft aus.
Der Streit ereignet sich in einer Zeit des wissenschaftlichen Umbruchs mit einer Fülle an neuen Erkenntnissen, in der es aber noch keine allgemein akzeptierten Mechanismen gibt, nach denen geklärt werden kann, wer etwas zuerst herausgefunden hat. Entdeckungen werden oft über Briefe diskutiert, nicht selten in der Form von Rundschreiben. Quasi den Status eines veröffentlichten Papers erlangen Briefe, die an die neu gegründeten Akademien und gelehrten Gesellschaften versandt und innerhalb dieser Zirkel diskutiert werden.
Den Sekretären dieser Gesellschaften kommt dabei eine zentrale Rolle zu: Sie vermitteln, leiten Briefe oder Kopien weiter, stellen ausgewählte Schriften zur Debatte. Henry Oldenburg, erster Sekretär der 1660 gegründeten Royal Society of London, schwingt sich mit der Zeitschrift The Philosophical Transactions of the Royal Society gar zum Herausgeber hoch. Er will in seinem Periodikum «von den Unternehmungen, Studien und Arbeiten der Geistreichen in aller Welt berichten».
Die Philosophical Transactions (Erstausgabe März 1665) gelten neben dem Journal des sçavans (Paris, Januar 1665) und dem Giornale de’ Letterati (Rom, 1668) als Vorläufer der wissenschaftlichen Zeitschrift. Im Unterschied zu den ersten Publikationen der Akademien, die enzyklopädisch angelegt waren, zielen diese Periodika auf Neuheiten. In den Philosophical Transactions wird pro Artikel zumeist ein Experiment oder eine Beobachtung präsentiert. Dazu gibt es reichlich Kuriositäten, Klatsch und Tratsch.
Das grosse Zählen geht los
«Mit den streng formalisierten Journals und Papers, wie wir sie heute vor allem aus den Naturwissenschaften kennen, haben diese frühen Zeitschriften wenig gemein», erklärt Mathias Grote, Wissenschaftshistoriker an der Humboldt-Universität in Berlin. Und doch hätten sie wegweisenden Charakter. Als periodisch erscheinende Medien mit kurzen Artikeln bieten sie seit dem 19. Jahrhundert mehr und mehr Forschenden die Möglichkeit, ihre Resultate schneller zu verbreiten. Nun ist es nicht mehr nötig, ein ganzes Buch zu publizieren, wenn man eine Entdeckung bekanntmachen will.
Mit der Herausbildung von akademischen Disziplinen und Fachgesellschaften ab Mitte des 19. Jahrhunderts entwickeln sich aus den Journalen mit universalem Anspruch wissenschaftliche Fachzeitschriften, die sich durch fachbezogene Inhalte, strengere Formate und neuartige Prozesse der Qualitätssicherung von den Vorgängern, aber auch von den kommerziellen Zeitschriften mit Bezug zu Industrie und Gewerbe abgrenzen.
Noch lastet auf den Forschenden wenig Publikationsdruck. Das ändert sich im Kalten Krieg, als die Wissenschaften ins Wettrüsten einbezogen und die Forschungsgelder massiv erhöht werden. Als Kriterium für die Vergabe von Aufträgen und die Besetzung von Professuren etabliert sich die Anzahl der Publikationen und der Zitate dieser Beiträge. Mithilfe solcher Quoten, so ist man überzeugt, lassen sich die Kompetenzen und Forschungsleistungen objektiv bewerten.
«Warum sollten wir die Techniken der Wissenschaft nicht auf die Wissenschaft selbst anwenden?», bemerkt Derek de Solla Price, Mitbegründer der Szientometrie, der Lehre vom Messen wissenschaftlicher Aktivitäten, 1962 in einer Vorlesung. Ab den späten 1960ern finden sich die dazu erforderlichen Daten auf Zitationsdatenbanken wie dem Science Citation Index, dem Web of Science, Scopus oder Google Scholar.
Die Macht der Verlage
«Publish oder perish» wird zum Gesetz in der Wissenschaftsgemeinde. Globale Verlagskonsortien wie Springer, Elsevier oder Wiley, die sich in den 1980er-Jahren nahezu alle relevanten – mit hohem Impact-Faktor bewerteten – Zeitschriften und Editionen einverleiben, erlangen eine Machtposition, die es ihnen ermöglicht, riesige Gewinne zu generieren. Das Geschäftsmodell ist so einfach wie genial: Die Forschenden geben ihre Manuskripte gratis ab, sogenannte Peers begutachten diese gratis, und die Universitäten, in Konkurrenzkampf untereinander, lassen sich auf stetig steigende Abopreise ein.
Doch das Modell kommt ab den 1990er-Jahren unter Druck: Die Bibliotheken sind nicht mehr gewillt, bis zu 20 000 Dollar für ein Abonnement zu bezahlen, und immer mehr Behörden fordern die kostenfreie Veröffentlichung der Resultate von staatlich geförderten Forschungsprojekten. 1999 wird mit Biomed Central der erste Open-Access-Verlag gegründet – heute im Besitz von Springer und mit über 180 peer-reviewten Zeitschriften der weltweit grösste Open-Access-Anbieter. Die Verlage passen ihr Geschäftsmodell an: Nicht mehr die Bibliotheken, sondern die Forschenden zahlen für ihre Veröffentlichungen.
Parallel dazu entstehen Online-Plattformen, auf denen Forschende ihre Studien gratis veröffentlichen können, zumeist ohne vorgängigen Peer-Review. Solche Preprints etablieren sich insbesondere in Medizin, Biologie, Mathematik und Physik. Ein beschleunigtes Verfahren bietet auch das noch junge, vor allem in der Biomedizin genutzte Format des Registered Report: Dabei werden vor der Durchführung der Studie zunächst die Methoden zu Papier gebracht und beim Journal eingereicht und dort begutachtet.
Häufiger, schneller, angesehener
Laut Andreas Boland, Assistenzprofessor für Molekularbiologie an der Universität Genf, lässt sich «noch nicht abschätzen, welches Format sich in Zukunft durchsetzen wird». In der Molekularbiologie sei das Tempo entscheidend. Darum würden viele Manuskripte in Form von Preprints auf die Plattform Biorxiv gestellt.
Interessant findet Boland auch Entwicklungen wie die Plattform Review Commons, auf der ein von Zeitschriften unabhängiger und rascherer Peer-Review durchgeführt wird. Sei eine Forschung aber von grosser Relevanz, entscheide man sich immer noch häufig für die Publikation in einem bekannten Journal wie Nature, Cell oder Science. Im Juni 2021 konnte seine Gruppe einen Artikel in Nature publizieren, «da haben wir natürlich Champagner aufgemacht».
Auch in der Physik habe die Anzahl der Preprints stark zugenommen, sagt Rachel Grange, Professorin für Quantenelektronik der ETH Zürich. «Doch noch immer ist das Publizieren in einer peer-reviewten Zeitschrift der Gold standard, insbesondere für die jungen Forschenden.» Und die Anzahl der Publikationen sei wichtig. «Ich sage immer: Qualität zählt, aber Quantität leider auch.»
Weil heute ausserdem die meisten Geldgebenden eine Open-Access- Publikation fordern, gerieten die Forschenden bisweilen in die Zwickmühle. «Für den Open Access verlangen die Journals zwischen 2000 und 6000 Franken pro Artikel. Das können sich nicht alle Forschungsgruppen leisten.» Auch die günstigere Variante mit einer Embargo-Frist von sechs oder zwölf Monaten könne aber problematisch sein. Denn oft werde unmittelbar nach Projektabschluss oder am Ende eines Stipendiums eine frei zugängliche Publikation erwartet.
Eine breite Palette an Publikationsformen nutzen die Geistes- und Sozialwissenschaften. In den Geschichtswissenschaften etwa würden Artikel nicht nur in peer-reviewten Journals, sondern auch in Sammelbänden publiziert, sagt Svenja Goltermann, Professorin für Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich. «Früher hat in solchen Bänden fast alles Platz gefunden, vielfach waren auch wenig relevante Vorträge darunter.» Mittlerweile aber würden bekannte Verlage wie Cambridge University Press oder Oxford University Press bei ihren Sammelbänden Peer-Reviews durchführen. «Dadurch gewannen die Publikationen an Bedeutung.»
Nahezu unverzichtbar für eine akademische Karriere sei aber das sogenannte zweite Buch, erklärt Goltermann. Gemeint ist eine Monografie, die auf die Dissertation folgt. Obschon es in diversen Disziplinen einen Trend zu kumulativen Dissertationen, also einer Zusammenstellung mehrerer inhaltlich zusammengehöriger Aufsätze gebe, sei die Monografie für die Geschichtswissenschaften auch in Zukunft unentbehrlich. Denn manche Argumente liessen sich nur im Buchformat ausführen.