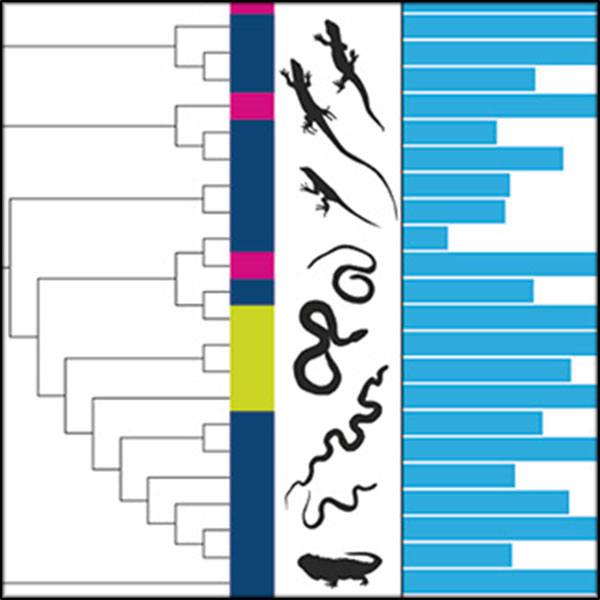ORGANSPENDEN
Wer schenkt wem eine Niere?
Nicht alle, die eine neue Niere brauchen, haben gleich gute Chancen auf eine Lebendspende. Eine Studie zeigt, wer eher profitieren kann.

Mütter spenden ihren Kindern meistens eine Niere, wenn diese es brauchen. Umgekehrt akzeptieren sie selten eine ihrer Kinder. | Foto: Sören Stache/DPA/Keystone
In der Schweiz machen Lebendspenden heute einen Drittel aller Nierentransplantationen aus. Sie haben den Vorteil, dass sie seltener abgestossen werden als Organe von Toten und die Wartezeit deutlich kürzer ist. Für die Spendenden sind die Risiken überschaubar. Aber nicht alle dürfen gleichermassen auf die Nierenspende einer lebenden Person hoffen, wie eine Studie nun festgestellt hat.
Für die Untersuchung im Rahmen der Swiss-Transplant-Kohortenstudie konnte das Team fast alle 2000 Personen befragen, an denen zwischen 2008 und 2017 erstmals eine Nierentransplantation durchgeführt worden war. Dabei zeigte sich: Schlechtere Aussichten auf eine Lebendspende haben vor allem Menschen, die älter sind, eine geringere Ausbildung haben, beschränkt arbeitsfähig sind oder nicht in einer festen Beziehung leben.
Weshalb aber beeinflussen Alter oder Ausbildung die Chancen auf eine Lebendspende? Zum einen, weil später im Leben die Wahrscheinlichkeit abnimmt, dass sich Eltern, Geschwister oder Partner als Spender eignen. «Die naheliegendste Spende ist die von den Eltern beziehungsweise der Mutter an das Kind. Da gibt es kaum je ein Nein», sagt Jürg Steiger, ärztlicher Direktor des Universitätsspitals Basel und Principal Investigator der Kohortenstudie. Eine Spende des eigenen Kindes hingegen, überhaupt eines viel jüngeren Menschen, komme für die meisten Erkrankten nicht in Frage. Jede dritte Lebendspende stammt zudem von der Ehefrau oder vom Lebenspartner.
Und: Wer besser ausgebildet ist, dürfte in der Regel mehr über Nutzen und Risiken einer Lebendspende wissen und so auch eher den Mut aufbringen, das Thema im Umfeld anzusprechen. Nicht, um jemanden direkt um eine Spende zu bitten – das falle den meisten schwer –, sondern um Klarheit zu schaffen. «Das Angebot kommt dann meist von den Spendenden selbst», so Steiger. Gezielte Information und ausführliche Arztgespräche seien deshalb gute Ansätze, um ungleiche Chancen wettzumachen. Dabei sollten Ehepartner und Familienmitglieder möglichst früh einbezogen werden.