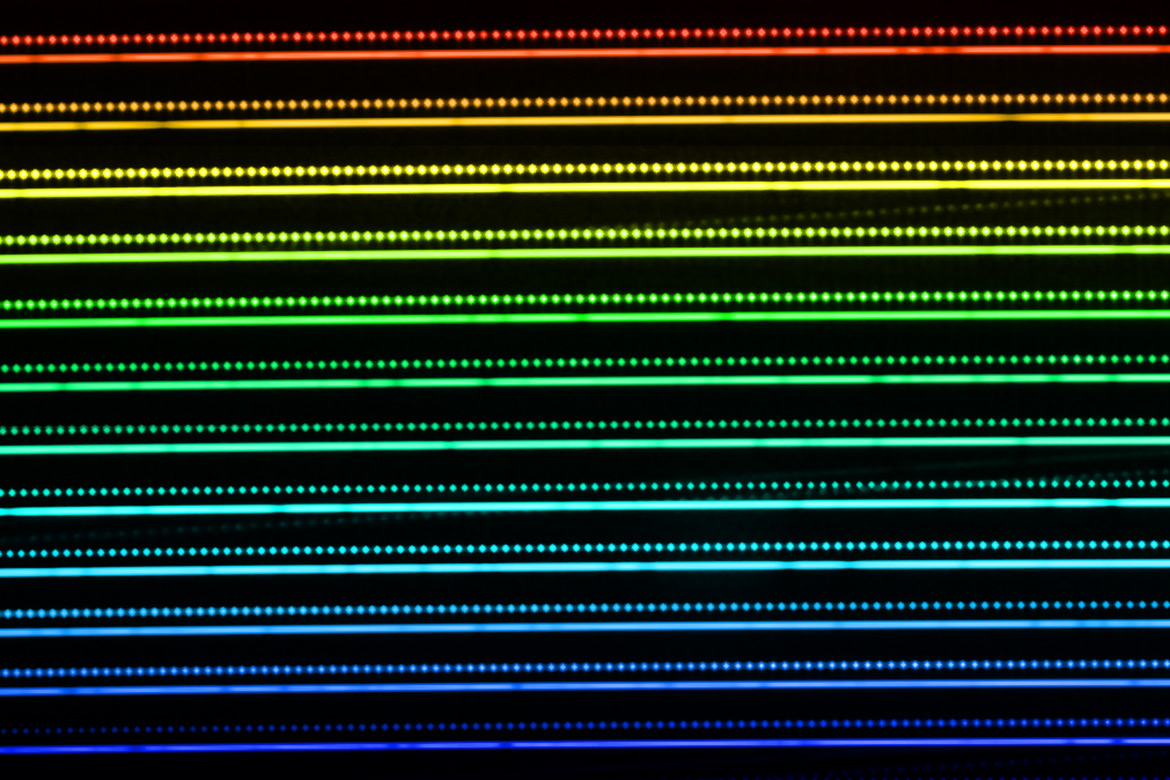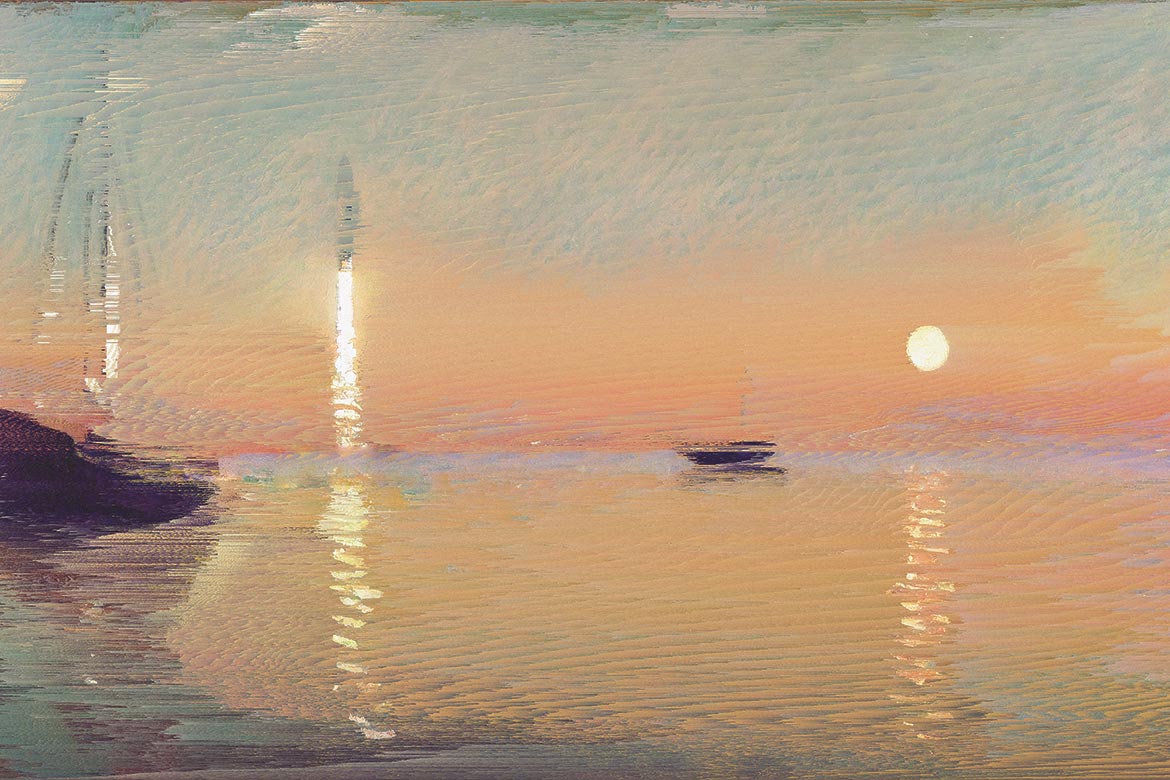Fokus: Wie das Geld fliesst
Das Rennen um die beste digitale Währung ist lanciert
Im Finanzwesen ist ein historischer Umbruch im Gang. Digitales Geld, basierend auf der Blockchain-Technologie, setzt sich zunehmend durch. Welche Form wird gewinnen?

Börsenkurse wie zu alten Zeiten im Ring: Die Zukunft der Währungen ist jedoch digital – nicht nur bei Kryptowährungen. | Foto: Tom Huber
Gerüchte über Facebooks Pläne einer Weltwährung kursierten schon länger. Der Paukenschlag erfolgte dann im Juni 2019, als das Projekt zunächst unter dem Namen Libra (später Diem) offiziell präsentiert wurde. Mit rund drei Milliarden Nutzenden weltweit wollte das damalige Facebook (heute Meta) eine neue, private Weltwährung etablieren, ohne jegliche Anbindung an nationale Zentralbanken. Diese schaffen Geld, indem sie Noten drucken oder Münzen pressen. Ihr Werkzeug zur Steuerung von Volkswirtschaften und zur Sicherung der Preisstabilität wäre stumpf geworden.
«Ohne den Libra-Schock wären wir bei der Digitalisierung von Geld noch lange nicht so weit, wie wir heute sind», sagt Hans Gersbach, Professor für Makroökonomie an der ETH Zürich und Mitinitiator des Finsure Tech Hub, an dem Wirtschaftswissenschaftler, Computerwissenschaftlerinnen, Mathematiker und Risikoanalystinnen interdisziplinär zu technologischen Umwälzungen im Finanzsystem forschen und lehren.
Facebooks Vorstoss habe schlafende Hunde geweckt, sagt Gersbach. «Das Rennen um die beste digitale Währung hat eine geopolitische Komponente. Es geht auch darum, welche die Weltwirtschaft in Zukunft dominieren wird.» Seither tüfteln Zentralbanken an eigenen digitalen Währungen, den Central Bank Digital Currencies, kurz CBDC. Kleinere und mittelgrosse Staaten wie etwa Nigeria, Bahamas und Jamaika haben bereits eine CBDC eingeführt. Die People’s Bank of China testet seit April 2021 die digitale Variante ihres Renminbi, in Kanada und Indien laufen Pilotversuche, die Europäische Zentralbank arbeitet seit 2020 an einem digitalen Euro, und die Schweizerische Nationalbank brütet gemeinsam mit der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und der SIX Group über der Implementierung eines digitalen Frankens.
«Was wir derzeit erleben, ist historisch», sagt Gersbach. «Aufgrund des technologischen Fortschritts wird sich unser Geldsystem grundlegend verändern.» Der Schweizer Franken als internationale Währung könnte in Bedrängnis kommen, wenn er den Sprung ins digitale Zeitalter nicht schafft. «Bargeld soll selbstverständlich bleiben», stellt der Ökonom klar. Aber es zeige sich, dass dieses immer weniger gefragt sei.
Zwar ist Bargeld in der Schweiz nach wie vor das häufigste Zahlungsmittel, aber die entsprechende Quote ist in allen fortgeschrittenen Volkswirtschaften gesunken. In Schweden sank sie zuletzt fast auf null. Beschleunigt wurde der Aufschwung von Kreditkarten, digitalen Überweisungen und Bezahl-Apps durch die Corona-Pandemie und die weitverbreitete Angst, dass Viren via Bargeld übertragen werden können. Auch werden Bargeldzahlungen zunehmend reguliert. So können in Frankreich etwa seit 2016 nur noch maximal 1000 Euro in bar bezahlt werden.
Laut Gersbach hat die digitale Form des Zentralbankgeldes für die breite Öffentlichkeit gewichtige Vorteile: Geld würde günstiger, weil es für die Herausgabe eines digitalen Frankens, anders als bei Münzen und Noten, weder eine Produktion noch eine aufwendige Logistik für die Verteilung braucht. Noch wichtiger sei jedoch: «Die Bürger hätten direkten Zugang zu digitalem Geld der Nationalbank – und damit zu einer sehr sicheren Währung.»
Weniger Strom und weniger Risiko
Zentralbankengeld, heute in Form von Münzen und Noten, ist das einzige hundertprozentig ausfallsichere Zahlungsmittel. Anders als das digitale Geld der Geschäftsbanken – also das Geld hinter der Zahl, die auf unseren E-Bank-Konten erscheint: Dieses ist lediglich eine Forderung für einen bestimmten Betrag in Banknoten. Gerät eine Bank ins Straucheln, kann diese verpuffen. Zu welcher Panik das führen kann, hat sich zuletzt im März beim Crash der Credit Suisse gezeigt.
Gersbach hat gemeinsam mit Roger Wattenhofer, Professor für Verteilte Systeme und Netzwerke an der ETH Zürich, einen Vorschlag erarbeitet, wie ein digitaler Schweizer Franken, sie nennen ihn den E-Franc, konzipiert sein könnte. Dieser soll frei in Bar- und Kontogeld umtauschbar sein und sichere Zahlungen mit dem heutigen Anonymitätsstandard ermöglichen. Der E-Franc würde einzig von der Nationalbank herausgegeben, die Geschäftsbanken fungierten aber weiterhin als Vermittler zwischen Nationalbank und Privaten.
Das System würde auf einer Blockchain mit zwei getrennten Ebenen laufen. Die eine wäre für die Sicherheit und Validierung der Transaktionen zuständig, die andere für die Verbindungen zwischen Zahlenden und Empfangenden. Dadurch soll das System schnell, skalierbar und sicher sein. Anders als zum Beispiel beim Bitcoin wäre beim E-Franc kein Proof of Work nötig, also keine Qualifizierung der Transaktion über Tausende von Knotenpunkten im Internet, die Unmengen an Strom frisst. Die Verifizierung beim E-Franc würde über wenige, vorbestimmte Akteure geschehen. «Der Energieaufwand wäre damit etwa gleich hoch wie bei heutigen Banktransaktionen über Internet», sagt Gersbach.
Seine und Wattenhofers Studie zeigt, dass der E-Franc technisch und regulatorisch möglich ist – und für die Öffentlichkeit wünschenswert. Denn laut Gersbach kann er eine disziplinierende Wirkung auf Geschäftsbanken haben. Für jeden digitalen Franken, den Kunden bei ihren Banken nachfragen, müssten die Geschäftsbanken nämlich genügend Reserven haben, um solche bei der Nationalbank zu kaufen. Sie könnten E-Francs nicht selbst schaffen, so wie heute das Buchgeld. «Tendenziell müssten sich Geschäftsbanken krisenfester aufstellen.» Die Folgen wären weniger riskante Kreditgeschäfte sowie weniger Volatilität und Finanzblasen im Wirtschaftssystem.
Bitcoin war nur der Anfang
Ende 2022 sah es für einen kurzen Moment so aus, als wäre das mit den Kryptowährungen doch nur ein grosser Hype gewesen: Facebooks Projekt war gescheitert, und Bitcoins hatten im November 2022 im Vergleich zum Jahresbeginn rund 60 Prozent an Wert verloren. Trotzdem sei dies noch lange nicht das Ende der Kryptowährungen, sagt Aleksander Berentsen, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel, der vorwiegend zu Blockchain und Kryptoassets forscht. «Natürlich gibt es beim Handel von Kryptowährungen viele Glücksritter, und teilweise herrscht Wilder Westen. Aber das ändert nichts daran, dass sich die Blockchain-Technologie im Finanzbereich durchsetzen wird.»
In der Forschung liege der Fokus heute vermehrt auf den Stablecoins. Das sind Kryptowährungen, deren Preise stabil sein sollen, da, anders als bei Bitcoin, ein Vermögenswert hinterlegt wird – so zumindest das Versprechen. Zur Schaffung und zum Handel von unterschiedlichen Stablecoins hat sich die Plattform Ethereum etabliert, die auf einer Blockchain basiert. «Ethereum ist deutlich effizienter als die bisherige Finanzinfrastruktur», sagt Berentsen. Er veranschaulicht dies anhand von Uniswap, einer dezentralen Kryptobörse auf der Ethereum-Blockchain: Diese wurde im November 2018 von Hayden Adams, einem früheren Siemens-Ingenieur, als Open-Source-Projekt entwickelt. Heute ist sie zentralisierten Börsen wie Coinbase und Nasdaq, gemessen am Umsatz pro Mitarbeitende, weit überlegen: Uniswap hat 2021 mit 37 Mitarbeitenden 1,2 Milliarden Dollar Gebühren eingenommen, bei Nasdaq waren es 3,4 Milliarden mit über 4700 Mitarbeitenden.
Den alles entscheidenden Unterschied machen die sogenannten Smart Contracts, die dem System von Uniswap zugrunde liegen. Sie erlauben, dass unzählige Funktionen für ein digitales Geldmittel programmiert werden können, zum Beispiel automatisierte Kontrollen gegen Geldwäscherei. Oder die Know-your-customer-Regulierung der nationalen Bankenaufsicht kann über sogenannte Whitelists automatisiert werden.
Berentsen rechnet damit, dass rund um die Ethereum-Blockchain ein ganzes Ökosystem von neuen Dienstleistungen im Finanzwesen entstehen wird. Darunter auch neue digitale Währungen in Form von privaten Stablecoins. Er geht davon aus, dass in Zukunft alle ein privates Kryptokonto haben werden und dass ein Grossteil des Finanzsystems auf eine Blockchain-Infrastruktur migrieren wird. Bargeld werde mittelfristig verschwinden und durch konkurrierende Kryptowährungen ersetzt werden, die eine begrenzte Anonymität ermöglichen.
Alles für immer einsehbar
Als Facebook 2019 seine Pläne bekannt gab, war die Angst gross, dass der Tech-Konzern mit einer eigenen Kryptowährung noch viel mehr Daten über seine Nutzenden sammeln könnte, als er es heute bereits über Facebook, Instagram und Whatsapp tut. Deshalb plädieren auch Rechtsexpertinnen dafür, dass Staaten die Herausgabe von digitalisierten Währungen nicht einfach der Privatwirtschaft überlassen. Zwar ist das Libra-Experiment gescheitert, doch es ist ein offenes Geheimnis, dass sich andere Tech-Konzerne, darunter Google, für Kryptowährungen interessieren.
Vor diesem Hintergrund hat die Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung TA-Swiss unlängst eine Ausschreibung für die Risikoabschätzung von neuen virtuellen Geldformen lanciert. Darin heisst es, dass private Unternehmen «signifikant an finanziellem und politischem Einfluss» gewinnen könnten und global verteilte Währungssysteme privater Unternehmen «bestehende Ansätze in der Regulierung des Zahlungsverkehrs auf nationaler Ebene infrage stellen».
Harald Bärtschi, Titularprofessor an der Universität Zürich, sagt: «Bei der Einführung eines digitalen Frankens braucht es auch eine politische Diskussion darüber, wie viel Datenschutz notwendig und wie viel Transparenz gerechtfertigt ist.» Der Jurist hat sich auf rechtliche Fragen rund um Finanztechnologie und Blockchain spezialisiert. Es liege in der Natur einer öffentlichen Blockchain, dass das Löschen der Daten praktisch unmöglich ist und alle Transaktionen dauerhaft gespeichert sowie auf der Datenkette einsehbar sind. Schliesslich sind Nachverfolgbarkeit und Transparenz das grosse Versprechen, mit dem die Blockchain angetreten ist, auch wenn Bitcoin mittlerweile zu den beliebtesten Zahlungsmitteln des organisierten Verbrechens und bei Hackerangriffen gehört.
Cash dagegen zeichnet gerade aus, dass dieses Geld praktisch keine Datenspuren hinterlässt. Wo bliebe bei einem kryptobasierten E-Franken das Recht auf Vergessen, zum Beispiel bei persönlichen Geschäften, die Jahre zurückliegen? Oder was ist mit dem Recht auf Privatsphäre und Datenschutz, wenn alle privaten Geldtransaktionen für die Betreiber oder Behörden auf der Blockchain sichtbar wären?
Schweizer Politik ist zögerlich
Ob die Schweiz zu den Vorreitern der digitalen Währungen gehören wird, ist ungewiss – trotz dem Zuger Crypto Valley und den hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung. 2019 kam der Bundesrat zum Schluss, dass allgemein zugängliches digitales Zentralbankengeld für die Schweiz keinen Zusatznutzen brächte. Auf Anfrage bei der Schweizerischen Nationalbank heisst es, dass aktuell verschiedene Projekte zu einer CBDC laufen, diese jedoch «rein explorativen Charakter» haben und «nicht als Hinweis für oder gegen eine Einführung einer CBDC zu verstehen» seien. «In der Politik geht es nur schleppend voran, und seit der CS-Krise ist man noch vorsichtiger geworden», sagt Hans Gersbach vom Finsure Tech Hub. «Das ist bedauerlich, denn mit dem E-Franken könnten wir irgendwann auch das Too-big-to-fail-Problem lösen.»
Die schrittweise Einführung des E-Franken würde gemäss Gersbach das Finanzsystem ohne aufwendige Regelwerke stabilisieren. Gekoppelt mit der Möglichkeit von Smart Contracts würde das den Wettbewerb auf dem Finanzmarkt verstärken, ist er überzeugt. Nach Jahrzehnten der Konzentration könnte der Finanzsektor dadurch wieder stärker dezentralisiert werden. Es ist deshalb wenig erstaunlich, dass sich grosse Geschäftsbanken und deren Vertreter und Vertreterinnen im Parlament vor solchen Umwälzungen fürchten. Ihre Privilegien sind bedroht, allen voran das Privileg, selbst Geld zu schöpfen und damit hochriskante und profitable Geschäfte zu tätigen – oft losgelöst von der Realwirtschaft.
Trotzdem glaubt Gersbach, dass es mit der Einführung des E-Franken plötzlich auch sehr schnell gehen könnte. «Die Fortschritte beim E-Euro werden auch die Schweizer Politik unter Druck setzen.» Wenn die EU-Mitgliedstaaten und der Rat der Zentralbank mitziehen, könnte der E-Euro bereits 2026 verfügbar sein. Wahrscheinlich werde sich in einigen Jahren eine Minimalvariante eines digitalen Frankens durchsetzen, mit Umwandlungsbeschränkungen und langen Einführungsphasen, so Gersbach. Das wäre dann zwar weit weniger disruptiv, als es sich die Tech-Konzerne im Silicon Valley wünschen. Dafür aber demokratisch legitimiert, rechtlich gut abgestützt und volkswirtschaftlich gut verträglich.
Illustrationen: Niels Blaesi