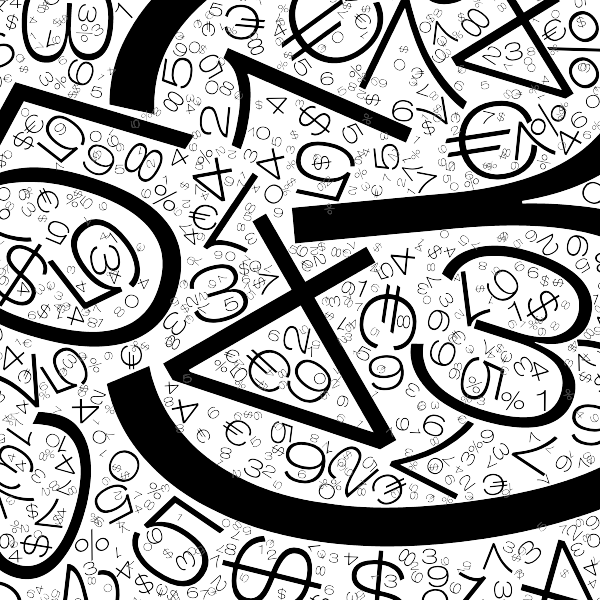ENERGIE
Vom Siegeszug fossiler Treibstoffe bis zur Mission emissionsfrei
Nicht immer war so klar, dass Benzin, Diesel und Co. die Wettfahrt gegen die Elektroantriebe gewinnen. Doch dann waren fossile Brennstoffe in der Mobilindustrie lange das Mass aller Dinge. Heute sieht das anders aus. Wohin es geht mit den Treibstoffen für Autos und Flugzeuge.

Das flüssige Gold Benzin erlebte immer wieder Krisen, so etwa in den 1970ern, doch es setzte sich bis jüngst gegen Batterien durch. | Foto: Mary Schroeder
An einem Sommertag im Jahr 1888 macht sich Bertha Benz mit dem Motorwagen Nr. 3 ihres Mannes Carl auf den Weg von Mannheim zu ihrer Mutter nach Pforzheim. Die Strecke ist zu weit, um sie mit einer Tankfüllung zu bewältigen. Die mitgeführten Flaschen mit Leichtbenzin reichen nicht aus. Kurz vor dem Ort Wiesloch ist der Tank leer. Die letzten hundert Meter müssen Frau Benz und ihre beiden Söhne schieben, bis zur Stadtapotheke am Marktplatz. Dort kauft Benz drei Liter des Reinigungsmittels Ligroin, das auch als Treibstoff taugt – so wird der Ort zur ersten Tankstelle der Welt.
Die Geschichte der fossilen Treibstoffe beginnt also durchaus holprig, der Systemstreit zwischen Elektroantrieb und Ottomotor war noch nicht wirklich entschieden. Auch die konkurrierenden Batterien hatten nur eine geringe Reichweite – und Strom war nicht überall verfügbar. «Anfangs war die Treibstoffquelle noch offen», sagt Peter Affolter, Leiter Automobiltechnik an der Fachhochschule Bern. «Erst mit der Erfindung des Anlassers im Jahr 1911 war der Siegeszug der flüssigen, fossilen Treibstoffe nicht mehr aufzuhalten.»
Derzeit scheint sich die Geschichte umzudrehen. Eine weitreichende Elektrifizierung auf Basis regenerativer Energien gilt als vielversprechende Lösung. Die fossilen Treibstoffe stehen als Treiber des Klimawandels in der Kritik. Die Suche nach Alternativen beschäftigt Forschende weltweit. Allerdings sind die vergleichsweise billigen fossilen Treib- und Brennstoffe universell einsetzbar, vom kleinen Mofa über alle Arten von Fahrzeugen, Schiffen, Wärme- und Stromerzeugungsanlagen bis hin zu Helikoptern, Militärjets und Langstreckenflugzeugen. «Die fossile Energie hat das Wirtschaftswachstum überhaupt erst in diesem Masse ermöglicht, aber gleichzeitig auch den Klimawandel in Gang gesetzt», sagt Christian Bach, Leiter des Labors «Chemische Energieträger und Fahrzeugsysteme» der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) in Dübendorf.
Die Aufgabe ist also gewaltig: Es müssen sich alternative, klimaneutrale Treibstoffe für unterschiedliche Industriezweige finden. Die vielversprechendsten Kandidaten brauchen eine hohe Energiedichte und müssen sich zudem gut transportieren und speichern lassen. «Letztlich wird es darauf ankommen, ein Gleichgewicht zwischen Energieeffizienz, Kosten, Sicherheit und Umweltauswirkungen zu finden und dabei die besonderen Herausforderungen der einzelnen Branchen zu berücksichtigen», sagt Corsin Battaglia, Spezialist für Energieumwandlung an der Empa.
Kein Wunder also, dass die Abkehr von fossilen Brennstoffen schwerfällt, eine riesige Infrastruktur mit Raffinerien, Pipelines und Tankstellen ist entstanden. In einzelnen Sektoren wie bei stationären Heizungen könnte die Umstellung leichter sein. «Wärme als niederwertige Energieform lässt sich problemlos aus allen Energieträgern erzeugen», erklärt Peter Affolter.
Alle Fahrzeuge dagegen, auch Flugzeuge, Schiffe oder LKW, benötigen nicht nur höherwertige Energieträger, sie müssen ihren Treibstoff auch noch mitführen. Je grösser diese Autonomie, also ihre Reichweite sein muss, desto grösser ist laut Affolter der Leistungsbedarf des Fahrzeugs – eine Baumaschine braucht mehr Energie als ein Kleinwagen. Und je relevanter das Gesamtgewicht des Fahrzeugs für das Funktionieren ist, etwa bei Flugzeugen oder Schiffen, desto kleiner wird die Auswahl an alternativen Treibstoffen. Kerosinbetriebene Triebwerke im Flugverkehr etwa lassen sich nur schwer durch elektrische Antriebe ersetzen, weil der Schub zu gering ist.
E-Fuels sind kompatibel, aber ineffizient
Im Individualverkehr hingegen nimmt der Anteil der E-Autos zu. Neuartige Lithium-Ionen-Batterien haben eine Mobilität ermöglicht, wie wir sie von den Verbrennungsmotoren kennen. Es gibt aber immer noch Widerstand gegen die Umstellung, das politisch beschlossene «Verbrenner-Aus» der EU ab dem Jahr 2035 wurde zum Gegenstand kontroverser Debatten. Politiker priesen sogenannte E-Fuels – dabei steht E für elektrisch hergestellt – und weitere synthetische Kraftstoffe als Alternativen an. Es handelt sich dabei um künstliche, flüssige Kraftstoffe, die in komplexen, mehrstufigen und meistens energieintensiven Prozessen klimaneutral mithilfe von erneuerbarem Strom hergestellt werden. Gleiches gilt für synthetische Kraftstoffe aus Pflanzenabfällen, wo aus Biomasse wie altem Speiseöl mithilfe von Wasserstoff Diesel entsteht. Solche Biodiesel sind unter der Bezeichnung HVO – für Hydrotreated Vegetable Oils – bereits auf dem Markt. Ihr Vorteil: Sie sind kompatibel zu bestehenden Transportketten und zur Lagerinfrastruktur.
Das Konzept klingt zunächst einleuchtend. Allerdings ist der Wirkungsgrad der E-Fuels deutlich geringer als bei den E-Antrieben. Zudem sind sie teurer als das fossile Benzin. Das liegt auch daran, dass die Ausgangsstoffe Wasser und CO2 chemisch weit weg vom altbekannten Benzin sind. Experten wie Affolter mahnen, sorgfältig mit der neuen Ressource umzugehen: «Flüssige Treibstoffe, egal ob regenerativ hergestellt oder fossil, sind wertvoll und viel zu schade, um sie dort einzusetzen, wo es bereits heute gute Alternativen gibt.»
Die künstlichen Kraftstoffe können klimatechnisch dort sehr nützlich sein, wo keine Alternativen vorhanden sind. Empa-Forscher Bach sieht als möglichen Einsatzort Nutzfahrzeuge und Personenwagen mit hohen Laufleistungen, die nur schwer elektrifizierbar sind. Zudem brauche es E-Fuels für den Flugverkehr, industrielle Hochtemperaturprozesse und den internationalen Schiffsverkehr. Im Rahmen des Konsortiums Refuel.ch evaluiert die Empa mit rund zwanzig Industrie- und Wirtschaftspartnern aus der Schweiz und dem Oman die Möglichkeit, nachhaltige Treib- und Brennstoffe auf regenerativer Basis in Wüstenregionen herzustellen.
Und noch einen wichtigen Einsatzbereich sehen Expertinnen: E-Fuels könnten im Sommer überschüssige Energie aus erneuerbaren Quellen speichern. Bei Bedarf würden die Treibstoffe dann im Winter etwa in Gasturbinen verbrannt, um Strom zu erzeugen. Diese Doppelnutzung ist möglich, da Substanzen wie Wasserstoff, Methanol, Methan oder Ammoniak gute Energiespeicher sind. Liegen sie gasförmig vor, muss man sie allerdings entweder unter hohem Druck oder verflüssigt lagern und transportieren, damit dies wirtschaftlich bleibt. Dabei geht immer ein Teil der Energie verloren.
Die Zukunft liegt im richtigen Mix
Im Detail ist die Situation dabei kompliziert. Es hängt von ökologischen und ökonomischen Faktoren ab, ob es vorteilhafter ist, überschüssige Energie im Sommerhalbjahr für die Langstrecken-Mobilität von LKW oder die Industrie nutzbar zu machen oder sie zu speichern, um im Winter Strom zu erzeugen. Klar ist, dass der allergrösste Teil aus Ländern importiert werden muss, die viel ungenutzte Wind- oder Solarenergie haben, sagt Empa-Forscher Bach. Es geht also nach Einschätzung vieler Fachleute nicht darum, die einzelnen Alternativen gegeneinander auszuspielen, sondern die verschiedenen Treibstoffe für jeweils passende Anwendungen zu nutzen.
Hier kommt auch ein einstiger Hoffnungsträger der Energiewende ins Spiel. Wasserstoff galt lange als grosser Konkurrent der E-Mobilität. Sein Einsatz in Brennstoffzellen wird immer noch erforscht. Allerdings liegt sein Wirkungsgrad mit rund 31 Prozent deutlich unter dem von E-Autos, aber höher als der von E-Fuels. Wasserstoff könnte dennoch eine grosse Rolle bei der Energiewende spielen, als alternativer Treibstoff im Schwerlastverkehr, bei Bussen oder auch im Flugverkehr, gemischt mit Ammoniak auch als Antrieb grosser Schiffe oder auch bei Hochtemperaturprozessen, etwa in der Stahlindustrie.
«Ich sehe Wasserstoff als einen zentralen Pfeiler des künftigen Energiesystems, vor allem beim Strom», sagt Mirko Bothien von der ZHAW School of Engineering in Winterthur. Die chemische Speicherung in Form von Wasserstoff sei eine gute Möglichkeit, um saisonale Schwankungen auszugleichen. Der Wasserstoff kann im Winter in Gasturbinen in Strom umgewandelt werden. Bothien arbeitet in EU-weiten Forschungsprojekten an der effizienteren Umwandlung von Wasserstoff in Strom, auch an der Entwicklung neuer Brenner für Wasserstoff und Gemische. «Wir sollten für alle Technologien offenbleiben», sagt Empa-Forscher Battaglia. «In Zukunft wird es wahrscheinlich einen Mix aus verschiedenen Technologien geben.»
Empa-Forscher Bach ist überzeugt, dass es noch viele Innovationen geben wird. «Eine Vision, die mir persönlich gut gefällt, ist das dynamische induktive Laden von Fahrzeugen auf Autobahnen während der Fahrt.» Solche in Strassenbeläge integrierten Ladesysteme würden es möglich machen, dass auch Fahrzeuge mit kleinen Batterien langstreckentauglich würden. Damit wäre auch das einstige Problem von Bertha Benz überwunden, die Suche nach einer Tankstelle. Denn die wäre dann überall.