Der Begriff
Resilienz
Wie die Idee, die eigene Belastbarkeit trainieren zu können, die Gesellschaft durchdringt. Und was daran problematisch ist.
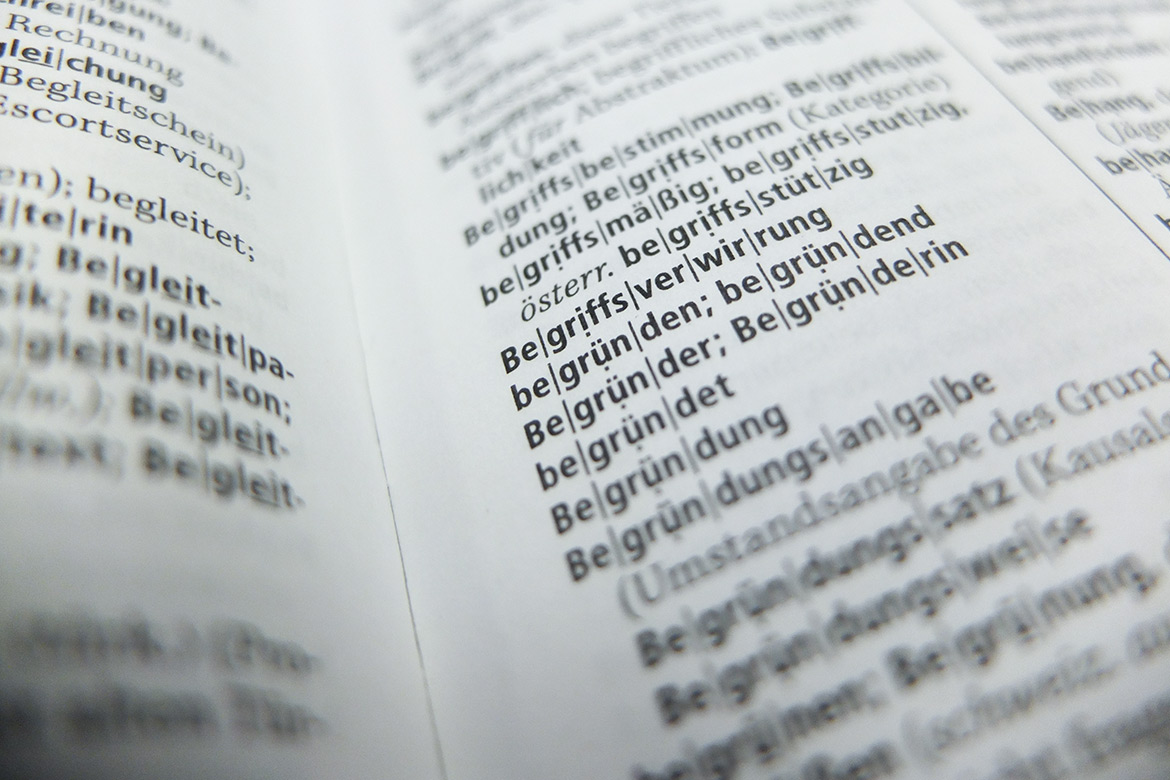
Foto: Florian Fisch
Gummi kann man verbiegen, er geht nicht kaputt. Tut man dasselbe mit Lehm, zerbröselt das Stück. Der Begriff Resilienz kommt aus den Materialwissenschaften. Inzwischen steht er aber für die Anpassungsfähigkeit von Menschen und Systemen an Störungen. Das hat mit seinem Siegeszug in der Entwicklungspsychologie zu tun, als man 1971 nach einer Langzeitstudie mit Kindern zum Schluss kam, dass Resilienz erlernbar und nicht angeboren ist. In den 80er-Jahren begründete dann Soziologe Aaron Antonovsky die Salutogenese: Er fokussierte auf das, was Menschen gesund macht – statt nach Ursachen für Krankheit zu fragen.
Heute durchdringt das Ideal die ganze Gesellschaft. Die Bertelsmann-Stiftung zog 2017 das Fazit, Resilienz sei «eine Art neuer Kompass» und verdränge zusehends den Begriff der Nachhaltigkeit. Gefährlich findet das Soziologin Stefanie Graefe: «Resilienz ist ein Alternativangebot zur Kritik an den Arbeitsbedingungen. Unter Verweis auf sie kann man Arbeitnehmenden sagen, wenn du mit den Bedingungen nicht klarkommst, dann musst du an deiner Belastbarkeit arbeiten.»




