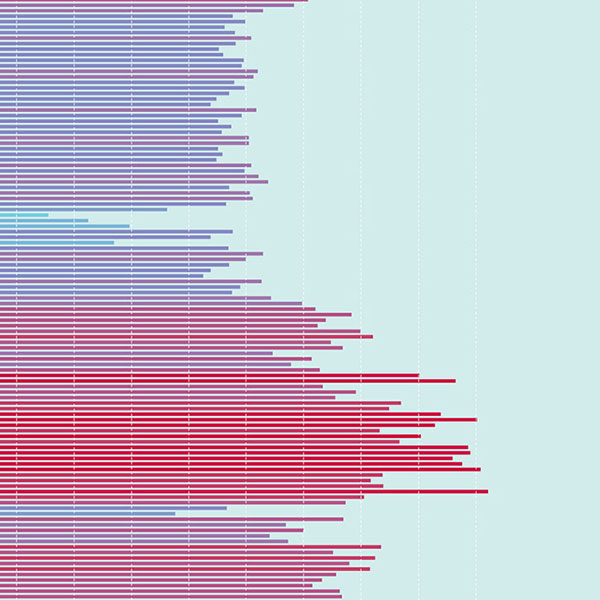Fokus: Forschen in der Krisenzone
Sie sind mitten im Krisenherd
Zwischen Rebellen und Regierung, unter gewaltbereiten Fussballfans oder in unkontrollierten Goldminen: Fünf Forschende berichten, wie sie mit Gefahren in Risikogebieten umgehen.

Alain Brechbühl - Institut für Sportwissenschaft, Universität Bern | Bild: Valérie Chételat
SCHWEIZ
«Einige Fans warfen Böller in meine Richtung»
Alain Brechbühl - An Sportveranstaltungen
«Gewalt ist ein interessantes Phänomen und leider Bestandteil unseres Lebens. Meine Forschung soll dazu beitragen, dass Sportveranstaltungen sicherer werden. Die Erkenntnisse fliessen weiter zu Partnern im Fussball und Eishockey. Gerade evaluiere ich das Good-Hosting-Konzept. Die Swiss Football League und die Klubs versuchen, die Gästefans stärker willkommen zu heissen und so das Gewaltpotenzial zu reduzieren. Ich beobachte den Eingangsbereich zum Stadion und befrage Gästefans während des Spiels.
Die grösste Gefahr ist, dass mich Fans mit zivilen Polizisten verwechseln. Die Fronten zur Polizei sind stark verhärtet. Deshalb stelle ich so viel Transparenz über meine Arbeit her wie möglich. Wenn ein Fan wissen will, was ich gerade aufgeschrieben habe, zeige ich ihm meine Notizen. Zudem habe ich einen Batch umgehängt, der mich als Forscher ausweist. Zwei Wochen vor dem Spiel hole ich bei den Klubs und der Fankurve des Gästevereins das Okay für meine Arbeit ein. Selten kommt es dennoch zu heiklen Situationen.
Vergangenes Jahr hielten mich Fans für einen Journalisten, worauf ich den Gästesektor verlassen musste. Vor ein paar Wochen meinten einige Fans ausserhalb des Stadions, ich sei ein Polizist, und warfen einen Böller in meine Richtung. Insgesamt ist mein Verhältnis zu den Anhängern jedoch gut und vertrauensvoll. Nur so ist meine Arbeit möglich. » sj

Aita Signorell - Schweizerisches Tropen- und Public-Health-Institut, Basel. | Bild: Valérie Chételat
DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO
«Angst hatte ich nie, dafür fehlte mir die Zeit»
Aita Signorell - Im Rebellengebiet
«Die Sicherheitslage im Kongo ist sehr volatil. Die grössten Risiken gehen von Krankheiten aus. Immer wieder kommt es zum Beispiel zu Choleraoder auch Ebolaausbrüchen. Ich habe eine klinische Studie im nördlichen Landesteil mit anspruchsvoller Sicherheitslage betreut. Eine Forschungsstation befand sich in einem undurchdringlichen und dicht bewaldeten Gebiet, wo die Lord’s Resistance Army aktiv war. In den umliegenden abgelegenen Dörfern kam es regelmässig zu Plünderungen und brutalen Angriffen durch die Rebellen.
Möglich war diese Arbeit nur durch die enge Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort, insbesondere mit Ärzte ohne Grenzen. Ich führte mit dem Gebietsverantwortlichen jeweils ein detailliertes Security-Briefing durch: jüngste Zwischenfälle, Ausgangssperren und No-go-Areas. Ich bewegte mich immer nur in Fahrzeugen, die mit Funk und Satellitensender ausgestattet waren.
Angst hatte ich nie, dafür fehlte mir auch die Zeit. Der Terminplan im Feld ist immer sehr eng getaktet. Aber ich befand mich jeweils in erhöhter Alarmbereitschaft. Schwierige Bedingungen sollten uns nicht davon abhalten, neue Wirkstoffe vor Ort zu testen. Auch die Menschen dort haben ein Recht auf die Erforschung ihrer Gesundheitsprobleme und auf medizinische Versorgung.» sj

Julia Palmiano Federer - Stiftung Swisspeace und Universität Basel | Bild: Valérie Chételat
MYANMAR
«Westliche Kleidung ist der beste Schutz»
Julia Palmiano Federer - Bei Waffenstillstandsverhandlungen
«Obwohl viele meiner Interviews zum Friedensprozess in Myanmar im geschützten Rahmen in Hotels stattfanden, war doch immer eine Bedrohung spürbar – vor allem für meine Gesprächspartner von ethnischen Minderheiten. Die eigene Meinung zu äussern verlangt Mut. Ich untersuche die Rolle von Mediatoren aus NGOs bei Waffenstillstands-Verhandlungen: Bringen sie ihre Normvorstellungen in die Verhandlungen ein? Ich muss bei Treffen an die Risiken für meine Interviewpartner denken und sie nicht der Regierung ausliefern. Ich verbrachte 18 Monate für die Forschung in Myanmar, zuletzt bis im August 2018 in Mawlamyine. Myanmar ist ein Vielvölkerstaat mit 135 ethnischen Gruppen – teilweise noch bewaffnet.
Die Forschung ist riskant. Ich meine damit nicht alltägliche Gefahren, die jeder Tourist kennt. Es ist das Gefühl, ständig ohne Vorwarnung in Schwierigkeiten geraten zu können. Einmal wurde ich zum Treffen mit einem hohen Regierungsbeamten von Soldaten zu dessen Haus begleitet – von Maschinengewehren umgeben. Nach Minuten des Schweigens begann ich auf Englisch zu sprechen, sofort hielt mir meine Begleiterin den Mund zu. Es gab hektische Diskussionen, die ich nicht verstand. Sie hatte mich als Einheimische vermittelt, um den Termin zu erhalten. Viele Leute sagen, ich sehe wie eine Einheimische aus. Ich bin in Manila geboren und bin mit meinen Eltern nach Vancouver ausgewandert.
Das Orwellsche Gefühl
In Myanmar habe ich anfangs gern einheimische Kleidung getragen. Bis mich ein Mann wütend bedrängte, als er merkte, dass ich trotz meines Aussehens keine Einheimische bin. Auch bei Interviews irritierte es Gesprächspartner, dass ich nicht die Landessprache spreche. Dabei ist es der beste Schutz, westlich gekleidet zu sein und Englisch zu sprechen, ebenso mein kanadischer Pass und mein Arbeitsvisum. Ohne kann man auf dem Land schnell in Gefahr geraten. In Myanmar kann es immer noch gefährlich sein, seine Meinung zu teilen. Es bleiben Reste dieses alten Orwellschen Gefühls.» hf

Fritz Brugger - Zentrum für Entwicklung und Zusammenarbeit (NADEL), ETH Zürich | Bild: Valérie Chatélat
BURKINA FASO UND TSCHAD
«Wir müssen die lokalen Machtstrukturen respektieren»
Fritz Brugger - Beim Rohstoffabbau
«Gerade arbeiten wir an einem Projekt im Norden von Burkina Faso. In einer Region, in der es zuletzt zunehmend zu gewaltsamen Konflikten gekommen ist. Wir forschen dort zu Kleinbergbau in Goldminen, dem sogenanntem Artisanal and Small-Scale Mining. Die Menschen schürfen dort das Edelmetall ohne Kontrolle durch die Behörden. Die Minen sind nicht viel mehr als einfache Gruben. Menschen steigen in enge Schächte ab und tauchen mit gefüllten Kübeln wieder auf. Sie arbeiten mit Pickel, Schaufel und hochgiftigen Chemikalien.
Wir interessieren uns für die Frage, wofür die Goldgräber ihren Gewinn ausgeben. Es besteht die etwas stereotype Annahme, dass die Männer das Geld für Frauen, Alkohol und Motorräder verjubeln. Wir wollen wissen, wie weit das zutrifft und ob nicht auch ein Teil des Geldes in die Landwirtschaft zurückfliesst, aus der die meisten Minenarbeiter kommen, oder ob es für produktive Investitionen verwendet wird. Forschungskolleginnen und -kollegen untersuchen parallel die Auswirkungen des Goldabbaus auf die Arbeiter und die Umwelt.
Als fremder Europäer trifft man im Umfeld der Minen grundsätzlich einmal suf Skepsis. Die Arbeiter halten dich für den Vertreter einer Bergbaufirma, die das Gebiet für sich beanspruchen will oder sie befürchten, du meldest der Regierung die Verwendung von verbotenem Zyanid. Der Empfang kann deshalb durchaus unfreundlich ausfallen. Eine grosse Herausforderung ist oft die unübersichtliche Situation vor Ort. In den grössten Minen arbeiten bis zu tausend Menschen. Eine zentrale Verwaltung gibt es keine, stattdessen verschiedene Patrons mit eigenen Schächten und Angestellten. Daneben existieren traditionelle Landrechte und lokale Autoritäten. Daraus ergibt sich ein komplexes Netz von Machtstrukturen und Abhängikeiten, das sich nur schwer durchblicken lässt.
Wir arbeiten deshalb mit lokalen Partnern, die mit der Situation vertraut sind. Sie klären ab, wer vor Ort die Entscheidungsträger sind und befinden letztlich darüber, ob wir auf den Minen tätig sein können. Wir müssen deshalb immer auch persönlich bei allen einflussreichen Autoritäten vorsprechen. Es ist wichtig, dass die Menschen vor Ort unsere Ziele und unser Vorgehen verstehen. Sie wollen Gewissheit, dass unsere Arbeit ihr Geschäft nicht bedroht. Schliesslich verdienen sie ihr Leben damit. Nur wenn wir die lokalen Machtstrukturen verstehen und respektieren, können wir unsere Forschung sicher durchführen.
Der Aufbau von Vertrauen erfordert Geduld und Respekt gegenüber den Menschen auf allen Seiten. Auch wenn Kinder in den Minen arbeiten, Arbeiter ausgebeutet werden oder die Umwelt leidet. Nur wenn wir uns ohne Werturteile auf die Menschen vor Ort einlassen, können wir seriös forschen. Das Vertrauen gewinnen wir immer nur vorläufig. In Burkina Faso sind wir deshalb nach der ersten Forschung zurückgegangen, um unsere Ergebnisse allen Beteiligten vor Ort zu präsentiert. Das wurde sehr geschätzt. Im Tschad habe ich mich auch schon mit Vertretern von Ölfirmen informell zum Essen getroffen, um eine Beziehung aufzubauen. Es gibt aber auch klare Grenzen: Abkürzungen über Bestechung sind keine Option. Das führt nur zu weiteren Schwierigkeiten.
Politisch aufgeladenes Thema
Trotz aller Vorsichtsmassnahmen können Situationen eskalieren. Besonders dann, wenn wir uns ungeschickt verhalten oder eine Situation nicht mit der nötigen Umsicht betrachten. Ich war kürzlich in einem Gebiet in Burkina Faso, als gerade eine neue Goldmine entdeckt wurde. Wie aus dem nichts, kamen aus allen Richtungen hunderte von Minenarbeitern mit ihren Motorrädern angefahren. Die Nervosität war spürbar. Als Weisser hältst du in einem solchen Moment besser Distanz. Einige Wochen später bin ich in ein Dorf gefahren, um mit den Bewohnern über ihre Erfahrung mit einer industriellen Mine in ihrer Nachbarschaft zu sprechen. Die Stimmung war ziemlich angespannt. Als die Gereiztheit zunahm, beschloss ich mein Vorhaben abzubrechen und weiterzufahren.
Das Forschungsthema ist politisch stark aufgeladen – besonders im industriellen Bergbau, wodurch wir leicht zur Projektionsfläche für bestehende Konflikte werden. Bei meiner Arbeit, muss ich deshalb immer das grössere Bild lesen und verstehen, in welchem Kontext ich mich bewege: Welche Konflikte existieren, wo liegen die Konfliktlinien und welche Risiken resultieren daraus für unsere Arbeit? Das stets im Blick zu behalten, ist eine grosse Herausforderung.» sj

Christelle Rigual - Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung (IHEID), Genf | Bild: Valérie Chételat
NIGERIA UND INDONESIEN
«Die Forschenden spielen das Erlebte herunter»
Christelle Rigual - In der Friedensförderung
«Wir analysieren den Einfluss von Genderaspekten auf Gewaltprozesse, die Konfliktbewältigung und die Friedensförderung in verschiedenen Regionen Indonesiens und Nigerias. Insbesondere, was als männlich gilt, prägt die gesellschaftlichen Vorstellungen und die individuellen, kollektiven und institutionellen Verhaltensmuster massgeblich.
Forschung in diesem Bereich ist mit zahlreichen Risiken verbunden. Einer Kollegin von mir wurde bei einem bewaffneten Überfall das Auto entwendet. Auch ihr Laptop wurde gestohlen, womit sie einen beträchtlichen Teil ihrer Forschungsdaten verlor. In Indonesien verlangten Mitglieder einer bewaffneten Gruppe, dass sie interviewt werden. Die Konfrontation endete glücklicherweise friedlich. Im vergangenen Jahr hat das Wiederaufflammen von Gewalt in gewissen Gemeinschaften im zentralnigerianischen Hochland zu Strassenblockaden und Ausgangssperren geführt. Deshalb mussten wir darauf verzichten, einen Dokumentarfilm über unsere Forschungsarbeit zu drehen. Gewisse Gefahren sind nicht vorhersehbar. Ich wollte 2018 während eines Forschungsaufenthalts in Indonesien die Insel Lombok erkunden und erlebte dann ein Erdbeben. Zwar blieb ich unverletzt, doch ich habe mich gefragt, ob meine Forschung den Preis wirklich wert ist. Die Antwort lautet weiterhin: ja.
Gefährliche Ironie
Meines Erachtens fehlt eine Plattform, auf der sich Forschende über die Risiken vor Ort informieren und sich entsprechend vorbereiten können. Aus meiner Sicht als Expertin für Genderfragen fällt mir auf, dass die Forschung von sehr männlichen Idealen geprägt ist. Dieses lässt wenig Platz, um Emotionen zu zeigen und über Ängste zu sprechen. Forschende, die angespannte Situationen erlebt haben, spielen diese Gefahren nach ihrer Rückkehr häufig herunter oder erzählen mit Ironie davon. Das führt zu einem Teufelskreis aus Isolation und mangelnder institutioneller Begleitung der Forschenden.» pm