Wenn Forschende vor Gericht antraben müssen
Wissenschaft landet immer wieder im Gerichtssaal oder wird selber Gegenstand von Untersuchungen. Mal sind die Forschenden Kläger, mal Angeklagte. Manche Fälle sind kurios, andere geben zu denken. Eine Auswahl.
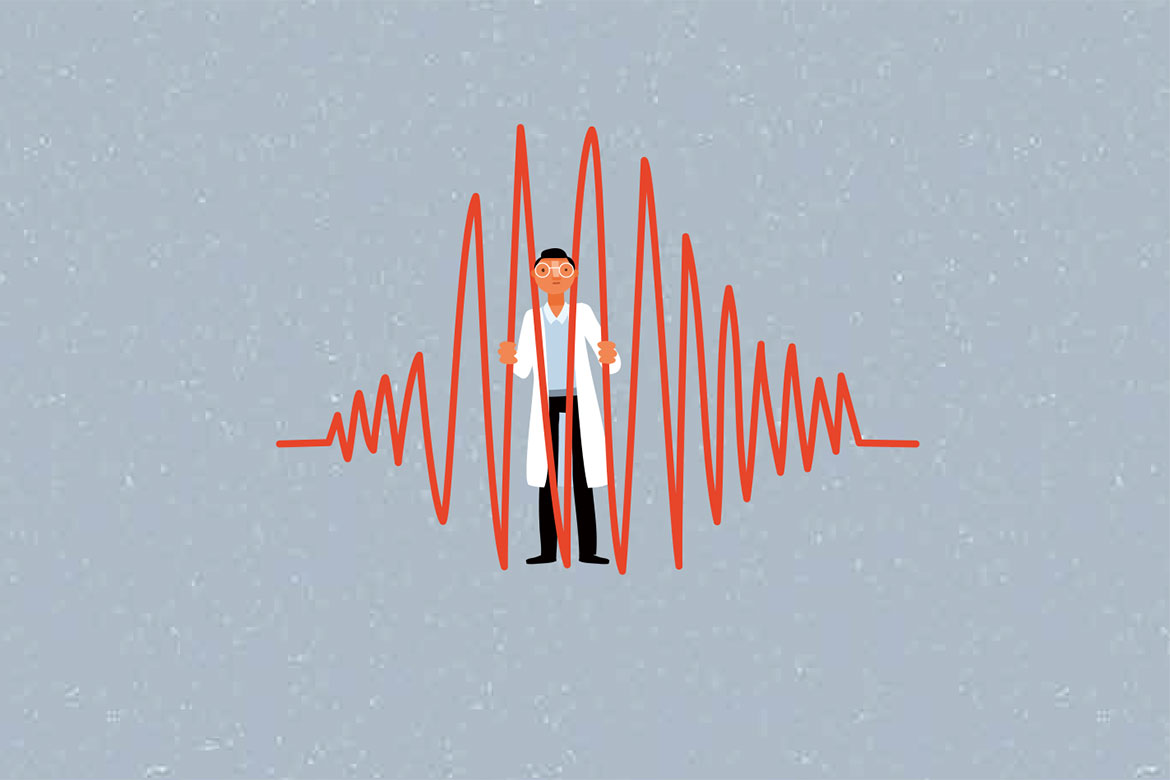
Illustration: Christoph Frei
Tödliche Beschwichtigungen
Wissenschaftler auf der Anklagebank
2012 / L’Aquila (I) Regierung vs. Geologen
Wie um Himmels willen können Wissenschaftler dafür verurteilt werden, ein Erdbeben nicht vorhergesehen zu haben? Das fragten sich viele, als 2012 sieben Experten wegen fahrlässiger Tötung angeklagt und zu sechsjährigen Gefängnisstrafen verurteilt wurden – für Einschätzungen, die sie 2009 im Vorfeld des tödlichen Erdbebens in L’Aquila (I) abgegeben hatten.
Die Anklage gegen die sieben Experten, darunter der Seismologe Enzo Boschi (siehe Interview: «Ich würde alles gleich machen»), lautete denn auch anders. Sie hatten am Treffen einer staatlichen Kommission für Risikoeinschätzung teilgenommen, wenige Tage vor dem Beben mit Magnitude 6,3. Zuvor war es während Monaten zu kleineren Erschütterungen gekommen. Die Experten wurden wegen unangebrachter Beschwichtigungen angeklagt, da diese einige der 309 beim Beben getöteten Menschen dazu verleitet habe, in ihren Häusern zu bleiben, statt wie gewohnt das Freie aufzusuchen.
Sechs der sieben Experten wurden nach der Berufung 2014 freigesprochen. Nur die zweijährige Haftstrafe gegen den Katastrophenschutz-Beauftragten Bernardo De Bernardinis wurde bestätigt. Er hatte der Öffentlichkeit fälschlicherweise versichert, dass die Erdstösse «keine Gefahr» bedeuteten, da sich dabei Energie entlade und ein schweres Beben weniger wahrscheinlich mache.
Kommentatoren hatten bereits früher kritisiert, dass gegen alle Angeklagten dieselben Urteile ausgesprochen wurden. Max Wyss von der World Agency of Planetary Monitoring and Earthquake Risk in Genf wies darauf hin, dass De Bernardinis seine beschwichtigenden Kommentare vor dem Treffen gemacht hatte. Die Richter entschieden, die Experten hätten davon ausgehen müssen, kleinere Stösse würden ein grosses Beben wahrscheinlicher machen. Andere sahen das kritischer: Gemäss Francesco Mulargia, Seismologe an der Universität Bologna, kann die Wahrscheinlichkeit sogar hundert Mal grösser werden.
Gemäss Anna Scolobig, Sozialwissenschaftlerin an der ETH Zürich, zeigt das L’Aquila-Verfahren, wie komplex und delikat wissenschaftliche Beratung ist. Die Experten seien sowohl mit wissenschaftlichen Unsicherheiten konfrontiert als auch mit der Unklarheit, wie weit sie mit konkreten Vorschlägen gehen sollten. In L’Aquila sei dies durch das «Mandat» der Katastrophenschutzbehörde verschärft worden, die Öffentlichkeit zu beruhigen.
Laut Scolobig werden Experten und Behörden künftig einem noch höheren rechtlichen Risiko ausgesetzt sein. Diese könnten nun eher falschen Alarm auslösen und sich allenfalls versichern. «Dadurch werden sie vielleicht nicht mehr wirklich im Interesse schutzbedürftiger Gemeinschaften handeln», warnt sie. ec

Bild: Keystone/ANSA/Guido Montani
«Ich würde alles gleich machen»
Enzo Boschi, der 2009 Präsident des Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia war, erinnert sich an das Verfahren.
Wie fühlten Sie sich, als Sie von der Anklage erfuhren?
Es war frustrierend. Ich war davon ausgegangen, dass die Untersuchungen bald abgeschlossen sein würden, weil ich mir überhaupt keiner Schuld bewusst war.
Wie erlebten Sie den Prozess?
Ich konnte nicht schlafen, hatte Albträume. Ich war sicher, dass ich freigesprochen würde, und wurde dann doch verurteilt. Es war dramatisch.
Wie reagierten andere Wissenschaftler auf das Urteil?
Ich bekam viel Unterstützung. Alle fanden das Verfahren komplett absurd. Ich bekam auch informelle Angebote für politisches Asyl und Arbeit von vier oder fünf Ländern.
Ist es je angebracht, Wissenschaftler anzuklagen?
Ja, wenn ich etwas weiss und es verschweige oder verändere. Wenn ein Politiker fragt: «Ist dieses Gebiet gefährlich?» und ich einfach verneine, ist das verwerflich. Aber wenn ich in gutem Glauben einen Fehler mache, dann nicht.
Wäre es ein Verbrechen, auf Befehl zu beschwichtigen?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich sprach mit dem Chef für Katastrophenschutz erst nach dem Beben. Ein anderer der Angeklagten sprach mit ihm nach dem Meeting und berichtete, dass alles wie geplant verlaufen sei.
Würden Sie heute etwas anders machen?
Nein, ich würde alles gleich machen. Während des Prozesses hielt uns die Bevölkerung von L’Aquila für inkompetente Verbrecher, welche die Leute nur in einer falschen Sicherheit wiegen wollten. Aber das ist absurd, ich habe nie jemanden beschwichtigt.
ec

Illustration: Christoph Frei
Zensur der Geschichte
Das Offensichtliche beweisen
2000 / Holocaust-Leugner vs. Historikerin
«Gewisse Dinge sind wahr: Elvis ist tot, die Polarkappen schmelzen, und der Holocaust ist tatsächlich passiert», versichert Deborah Lipstadt stets in ihren Vorträgen. Die US-amerikanische Historikerin forscht zu Holocaust-Leugnern wie dem Briten David Irving, der Auschwitz als Touristenattraktion bezeichnet. Irving fühlt sich von Lipstadts Buch «Betrifft: Leugnen des Holocaust» angegriffen und verklagte die Autorin und den Verlag Penguin Books wegen Beleidigung, übler Nachrede und Geschäftsschädigung. Und zwar in London, wo die Beweislast, anders als in den USA, beim Beklagten liegt. Geschichte müsse debattiert werden dürfen, führt er an.
Lipstadt musste nun nachweisen, dass der Holocaust eben nicht debattierbar ist – sondern so evident, dass ein Historiker ihn gar nicht leugnen kann. In einem beispiellosen Kraftakt bereiteten fünf hochkarätige Wissenschaftler die Verteidigung vor. Allein Richard Evans, Professor für moderne Geschichte in Cambridge, präsentiert nach 18-monatiger Recherche einen 740-seitigen Bericht. Der Richter konnte überzeugt werden und wies am 11. April 2000 Irvings Klage ab: Das Buch darf weiterhin ohne Einschränkungen verkauft – und Irving darin Holocaust-Leugner, Antisemit und Rassist genannt werden.
«Gute Wissenschaft braucht eine offene und kritische Diskussion», betont Stephanie Mathisen, Policy Manager der unabhängigen, britischen Lobbygruppe «Sense about Science». Ihr ist zu verdanken, dass eine Verleumdungsklage, wie Irving sie gegen Lipstadt anstrengte, heute in Grossbritannien nicht mehr möglich ist. Im Juni 2009 startete die Gruppe die Kampagne «Keep Libel Laws out of Science». Mit Erfolg: Ihre Kampagne mündete im Defamation Act von 2013, womit Publikationen über Belange von öffentlichem Interesse vor solchen Klagen geschützt sind – wozu Wissenschaft und Medizin gehören.
«Wer echte Wissenschaftler für begründete Kritik wegen übler Nachrede verklagt, identifiziert sich damit automatisch als Pseudowissenschaftler und Scharlatan», sagt der Wiener Biologe Erich Eder. Auch er fand sich im Jahr 2004 vor Gericht wieder, verklagt wegen Ehrenbeleidigung, Kreditschädigung und Unterlassung von der Firma Grander, die «belebtes» Wasser verkauft, das angeblich Heilkräfte besitzt. Grund für die Anklage war ein Leserbrief, in dem er die Versprechen als «parawissenschaftlichen Humbug» bezeichnete. So offensichtlich es für Wissenschaftler auch sein mag, dass normales Wasser keine übernatürlichen Kräfte besitzt – erst in zweiter Instanz entschied der Richter den Fall für Eder. af
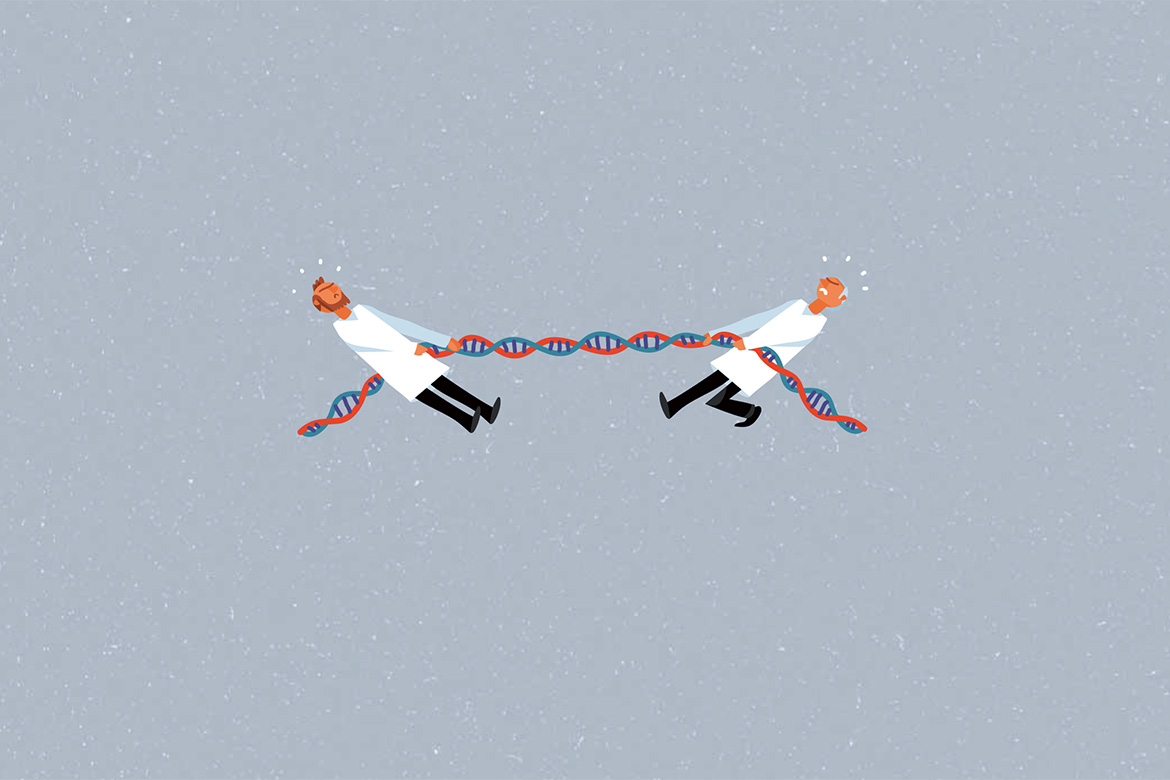
Illustration: Christoph Frei
Wer hat’s erfunden?
2017 / CRISPR-Cas: Forschende vs. Forschende
Sie gilt als Revolution der Gentechnologie: Die CRISPR-Methode eröffnet die Möglichkeit, Erbgut schnell und präzise zu verändern. Die Entdeckung dieser «Gen-Schere» wurde 2012 von Forschenden der University of California Berkeley verkündet.
Dieser Veröffentlichung folgte ein jahrelanger Streit um Patentrechte. Denn kurze Zeit später gelang es Forschenden am Broad Institute in Massachusetts, die CRISPR-Methode unter anderem in menschlichen Zellen anzuwenden, wofür dem Institut ein Patent zugesprochen wurde. Gegen diesen Entscheid reichte die University of California Beschwerde ein, mit der Begründung, dass die Übertragung der «Gen-Schere» auf menschliche Zellen keine eigenständige Erfindung sei. Das US-Patentgericht widersprach dieser Einschätzung und wies die Beschwerde im Februar 2017 ab.
Dieser Patentstreit zeigt die enorme ökonomische Relevanz der CRISPR-Technik. Statt sich auf wissenschaftliche und gesellschaftliche Konsequenzen des Verfahrens zu konzentrieren, wurde viel Energie in die Frage investiert, wer das Recht an dessen kommerzieller Nutzung hat.
Schaden Streite um Patentrechte also der Wissenschaft? Der ehemalige Chefökonom des Europäischen Patentamts Nikolaus Thumm relativiert: «In solchen Fällen streiten meistens nicht die Wissenschaftler selbst, sondern die für die Patente zuständigen Technologietransferstellen der jeweiligen Universitäten.» Letztere würden der Marktorientierung der Privatwirtschaft zwar in nichts nachstehen. «Aber die Forschung selbst ist davon meistens nicht betroffen.»
Für Thumm stellt sich die Frage, inwieweit die Forschung heute allgemein auf kommerzielle Nutzung ausgerichtet sein sollte: «Diese Debatte lässt sich nicht allein aus der Perspektive des Patentrechts beantworten.» Wenn Forschungseinrichtungen ihre Ergebnisse nutzen wollen, gäbe es im Moment kaum Alternativen zu Patenten. jr[/su_box]

Illustration: Christoph Frei
Affenversuche
43 Monate Wartezeit
2017 / Tierschützer vs. Neurowissenschaftler
Dreieinhalb Jahre musste Valerio Mante vom Institut für Neuroinformatik von Universität und ETH Zürich auf die Erlaubnis für seine Versuche mit drei Rhesusaffen warten. Er will psychische Krankheiten wie Schizophrenie besser verstehen. Obwohl der Antrag vom 1. Oktober 2013 von der Tierschutzkommission beim Veterinäramt bewilligt wurde, legten die drei Tierschutzvertreter der Kommission Rekurs ein. Eineinhalb Jahre brauchte der Regierungsrat, um den Versuchen erneut grünes Licht zu geben. Ein zweiter Rekurs vor dem Verwaltungsgericht kostete noch einmal über ein Jahr. Erst im April 2017, 43 Monate nach der Antragstellung, darf Mante seine Forschung beginnen: «Der Entscheid des Verwaltungsgerichts ist nun unanfechtbar.» af

Illustration: Christoph Frei
Angst vor der Apokalypse
Justiz soll Weltuntergang verhindern
Biochemiker vs. Cern
Auf der Suche nach dem Higgs-Boson könnten im Teilchenbeschleuniger des Cern kleinste schwarze Löcher entstehen. Wenn diese die Erde verschluckten, würden Teilchenphysiker damit das Recht auf Leben der gesamten Weltbevölkerung verletzen. So weit die Logik einer Beschwerde eines Biochemikers, die 2008 beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht wurde. Den entsprechenden Eilantrag gegen die Inbetriebnahme des Teilchenbeschleunigers LHC wies der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im August 2008 ab. Die Beschwerde selbst wurde 2010 von einem Einzelrichter für unzulässig erklärt. Ähnliche Klagen in den USA und beim deutschen Bundesverfassungsgericht wurden ebenfalls abgelehnt, da sie «unzureichend substanziiert» seien.
Diese Fälle stellen für Gerichte eine enorme Herausforderung dar. Denn sie müssen nicht nur über hochkomplexe physikalische Fragen befinden. Sie haben auch ein hypothetisches Risiko zu evaluieren, bei dem nichts weniger auf dem Spiel zu stehen scheint als der Fortbestand der Welt. Eric E. Johnson, Assistenzprofessor für Rechtswissenschaften an der Universität North Dakota, relativiert: «Es ist nicht die Aufgabe der Gerichte, in solchen Fällen selbst Wissenschaft zu betreiben.» Die Glaubwürdigkeit der Argumente beider Seiten könne durch andere Anhaltspunkte beurteilt werden: «Ein Gericht muss Faktoren wie die Organisation der Forschungseinrichtung, die Aktualität der Sicherheitsargumente, die anzunehmende Verlässlichkeit der Daten und allfällige Eigeninteressen der Klagenden analysieren.»
Müssen Richter also manchmal die Bevölkerung vor der Wissenschaft schützen? Rechtsprofessor Johnson verneint diese Frage: «Wissenschaftler sind nicht die Bösen.» Vielmehr sei die Wissenschaft ein humanistisches und nobles Anliegen, das es zu schützen und zu fördern gelte. Natürlich gebe es Experimente, die gewisse Risiken bergen. «Manchmal sind Wissenschaftler auch bereit, grössere Risiken in Kauf zu nehmen als Aussenstehende. In solchen Fällen kommt Richtern eine Vermittlungsfunktion zu.» jr

Illustration: Christoph Frei
Ideologischer Kampf in der Schule
Richter definiert Naturwissenschaft
2005 / Eltern vs. Schulbehörde
Lebewesen seien zu komplex, als dass sie durch die Evolution hätten entstehen können. Zufällige Mutationen und natürliche Selektion könnten bestimmte Eigenschaften des Lebens nicht erklären. Dafür brauche es die Intervention eines übernatürlichen, intelligenten Designers. So weit die Theorie des Intelligent Design.
Die Schulbehörde in Dover im US-amerikanischen Pennsylvania verlangte, dass diese Theorie gleichberechtigt neben der darwinistischen Evolutionstheorie unterrichtet werden sollte. 2004 ordnete sie an, dass Biologielehrpersonen ihren Schülern eine entsprechende Erklärung vorlesen.
Einige Lehrpersonen weigerten sich. Gemeinsam mit Eltern lancierten sie eine Klage, in der sie verlangten, dass Intelligent Design aus dem Biologieunterricht verbannt werden sollte. 2005 gab das Bundesbezirksgericht in Pennsylvania nach einem sechswöchigen Prozess den Klagenden in einem wegweisenden Grundsatzurteil recht: Bei Intelligent Design handle es sich nicht um Naturwissenschaft, sondern um eine wissenschaftlich getarnte Version des religiösen Kreationismus.
Der Biologe Nicholas Matzke ist der ehemalige Direktor des National Center for Science Education, das sich gegen religiöse Theorien im Wissenschaftsunterricht amerikanischer Schulen einsetzt. Er hält den Effekt des Urteils nachhaltig und bedeutend. «Der Prozess war sehr wichtig, um zu zeigen, dass das Unterrichten von Intelligent Design der Trennung von Kirche und Staat und damit der amerikanischen Verfassung widerspricht», sagt Matzke. «Das Urteil hat zudem dazu geführt, dass das Unterrichten von Intelligent Design an Schulen gestoppt wurde.»
Ein zentraler Bestandteil des Dover-Prozesses war die Analyse der Frage, was Naturwissenschaft ist und ob Intelligent Design als wissenschaftliche Konkurrenz zur Evolutionstheorie gelten kann. Die Antwort des Gerichts auf diese Frage war deutlich: Die Annahme eines übernatürlichen Designers kann nicht überprüft, also weder verifiziert noch falsifiziert und somit wissenschaftlich nicht untersucht werden.
Der Prozess zeigt, dass Gerichten die anspruchsvolle Aufgabe zukommt, sich neben der Anwendung von Paragraphen mit wissenschaftstheoretischen Fragestellungen zu befassen. Matzke sieht darin kein Problem – im Gegenteil: «Gerichte entscheiden häufig über Dinge, die wissenschaftliche Fragen enthalten. » Gerichte sollten immer wissenschaftliche Standpunkte einnehmen, sich in kritischem Denken üben, in ihrer Urteilsfindung Experten und wissenschaftliche Standards mit einbeziehen und auf diese Weise so gut wie möglich urteilen. jr

Illustration: Christoph Frei
Zweifel an der Therapie
Richter öffnen Forschungsdaten
2016 / Patienten und Forschende vs. Universität
Auf der einen Seite belegt eine grosse britische Studie («PACE») die Wirksamkeit von Psychotherapien beim chronischen Müdigkeitssyndrom. Auf der anderen Seite vertreten gewisse Patienten- und Forschungsgruppen den Standpunkt, dass es sich um eine biologisch bedingte Krankheit handle, weshalb sie die Studie öffentlich kritisieren. In der Mitte befinden sich die wissenschaftlichen Daten, die zu dieser Frage gesammelt wurden.
Gewissen Forschenden hat die Queen Mary University in London den Zugriff darauf verweigert. Sie argumentiert, es liege keine Einwilligung der Studienteilnehmenden zur Publikation der Daten vor, deren Anonymität sei gefährdet und dass dies eine Kampagne von Aktivisten sei. Die Argumente werden schliesslich durch ein zweitinstanzliches Gericht abgewiesen, das im September 2016
die Veröffentlichung der Daten anordnet. Die daraufhin gestellten methodologischen Fragen zur Interpretation der Ergebnisse werden die hitzig geführte medizinische Debatte weiter schüren. dsa

Illustration: Christoph Frei
Klimadaten manipuliert?
Attacke mit gehackten E-Mails
2009 / Klimaskeptiker vs. Wissenschaftler
Als der «schlimmste Wissenschaftsskandal unserer Generation» wurde er von einer britischen Tageszeitung bezeichnet: ein «Klimaskandal», der eigentlich keiner war. Der Hintergrund: Im Herbst 2009 wurden die Server der Universität von East Anglia in Grossbritannien gehackt. Dabei wurden von der Climate Research Unit (CRU) über 1000 E-Mails und 3000 weitere Dokumente entwendet, die später auszugsweise im Internet und in verschiedenen Medien publiziert wurden.
Der Vorfall stellte die Wissenschaft an den Pranger. Klimaskeptiker und Medien stürzten sich mit Verve auf vermeintliche Unsicherheiten in der wissenschaftlichen Klimadebatte. Für Furore sorgten insbesondere missverstandene und aus dem Kontext gerissene E-Mails, die suggerierten, dass die Klimawissenschaftler alle Resultate vertuschten, die ihnen nicht genehm waren.
Insgesamt acht voneinander unabhängige Untersuchungen durch Expertengremien – Parlamentsausschüsse, Universitäten und Wissenschaftsakademien – kamen zum Schluss, dass die Forschungsergebnisse der Klimawissenschaftler inhaltlich nicht beanstandet werden konnten. Übrig blieb die Kritik, dass die Forscher ihre Daten nicht öffentlich zugänglich gemacht und dass sie teilweise unsauber gearbeitet hatten, indem sie unterschiedliche Datensätze zusammenfügten, ohne dies entsprechend zu deklarieren.
Es sei deshalb wichtig, dass sich die Wissenschaft in einem konstanten Dialog mit der Öffentlichkeit und den Medien befindet, betont der Chemiker und Nobelpreisträger Paul Nurse. Er hatte sich in seiner damaligen Funktion als Präsident der Royal Society im Rahmen des BBC-Dokumentarfilms «Science under attack» intensiv mit dem «Climategate» auseinandergesetzt. «Die wichtigste Erkenntnis, die ich damals gewonnen habe, war, wie sehr sich manche Politiker, Medienschaffende und Aktivisten von ihren Ideologien statt von wissenschaftlichen Fakten und Vernunft leiten lassen», sagt Nurse. Gerade deshalb findet er es nicht hilfreich, wenn die Wissenschaft von den Medien und einer kritischen Öffentlichkeit an den Pranger gestellt wird. jr

Illustration: Christoph Frei
Freisetzung verhindern
Anwohnende fürchten sich vor Gentech-Weizen
2003 / Aktivisten vs. Biologen
Greenpeace-Aktivisten griffen 2003 mit einem Haufen Mist einen geplanten Feldversuch der ETH Zürich mit gentechnisch verändertem Weizen an. Der Protestaktion war eine langwierige Bewilligungsprozedur vorausgegangen: Viereinhalb Jahre wanderte der 1999 eingereichte Forschungsantrag zwischen verschiedenen Bundesbehörden hin und her, über 500 Seiten Gesuche und Rekursschriften wurden gefüllt. Schliesslich landete der Antrag vor dem Bundesgericht – besorgte Anwohnende hatten gemeinsam mit Greenpeace eine Klage eingereicht, die vom Gericht gutgeheissen wurde.
Das Bundesgericht entschied jedoch nicht über den Freisetzungsversuch, sondern darüber, ob es richtig gewesen war, der Einsprache der Anwohnenden die aufschiebende Wirkung zu entziehen. Beat Keller, der im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms NFP 59 später ähnliche Freisetzungsversuche durchführte, sieht beide Seiten solcher Verfahren: «Einerseits sitzen Mitarbeitende eines Forschungsprojekts oft auf Zeitverträgen. Bis ein Urteil gefällt wird, vergeht viel Zeit.» Tatsächlich mussten zwei Postdoktorandinnen aufgrund der Verzögerungen im Bewilligungsverfahren ihre Forschungstätigkeit einstellen. Andererseits anerkennt Keller auch die Rechtssicherheit, die solche Urteile in einem Rechtsstaat schaffen.
Sollen Anwohnende wissenschaftliche Experimente auf juristischem Weg verhindern können? Keller antwortet pragmatisch: «Eine Einsprachemöglichkeit ist im Gentechnikgesetz vorgesehen, und dies ist von den Wissenschaftlern zu akzeptieren.» Doch die Allgemeinheit müsse auch die negativen Folgen für den Forschungsplatz Schweiz mittragen. jr

Illustration: Christoph Frei
Falsch dargestellt
Gericht korrigiert Rezension
2016 / Historiker vs. Onlineplattform
Eine schlechte Rezension kann den Ruf eines Wissenschaftlers dauerhaft schädigen. Die übliche Prozedur, um die Ehre zu retten, ist in diesem Fall eine Replik. Der Historiker Julien Reitzenstein wählte einen anderen Weg und liess eine schädigende Rezension seiner Dissertation über das Institut für wehrwissenschaftliche Zweckforschung in der Zeit des Dritten Reichs gerichtlich unterbinden. Das Landgericht Hamburg untersagte auf Anfang 2017 die Veröffentlichung auf der Internetseite H-Soz-Kult, einem wichtigen Medium für geschichtswissenschaftliche Besprechungen. Die Betreiber von H-Soz-Kult nahmen die Rezension daraufhin zwar aus dem Netz, stellten an ihre Stelle jedoch eine neue – in der sie die ursprüngliche Version ausgiebig paraphrasieren und zitieren. af

Illustration: Christoph Frei
Gotteslästerung
Provokateur endet auf dem Scheiterhaufen
1600 / Inquisition vs. Philosoph
«Mit grösserer Furcht verkündigt ihr vielleicht das Urteil gegen mich, als ich es entgegennehme.» So lautet das berühmte Zitat des Philosophen und Theologen Giordano Bruno, kurz bevor er 1600 in Rom von der Inquisition wegen Ketzerei auf dem Scheiterhaufen hingerichtet wurde. Bruno war ein nonkonformistischer Denker, der mit seinen Werken aneckte. Als Verfechter eines unendlichen Universums und des kopernikanischen Weltbildes hatte er den göttlichen Schöpfungsmythos in Frage gestellt.
Anders als sein prominenter Zeitgenosse Galileo Galilei war Bruno auch unter Todesdrohungen nicht bereit, vor den Inquisitoren von seinen Überzeugungen abzuweichen. «Das faszinierende an Giordano Brunos Persönlichkeit ist, dass er bewusst ein Störenfried und Provokateur war», sagt Richard Blum, Philosophieprofessor an der Loyola University Maryland in Baltimore.
In diesem Fall wollte die Kirche ein Exempel zu statuieren. «Die Inquisitionsbehörde hat korrekt erkannt, dass Brunos Philosophie mit christlichen Dogmen nicht vereinbar war», erklärt Blum. Es sei eine kirchenrechtliche und religionspolitische Entscheidung gewesen, den abtrünnigen Dominikanermönch dafür der Hinrichtung auszuliefern.
Bruno war einer unter vielen, die von der Inquisition für ihr abweichendes Denken zum Tode verurteilt wurden. Dennoch glaubt Philosophieprofessor Blum nicht, dass diese Prozesse den Fortschritt massgeblich beeinflussen konnten. «Wissenschaftler haben fast immer Wege gefunden, ihre Theorien zu verfechten», sagt er. jr




