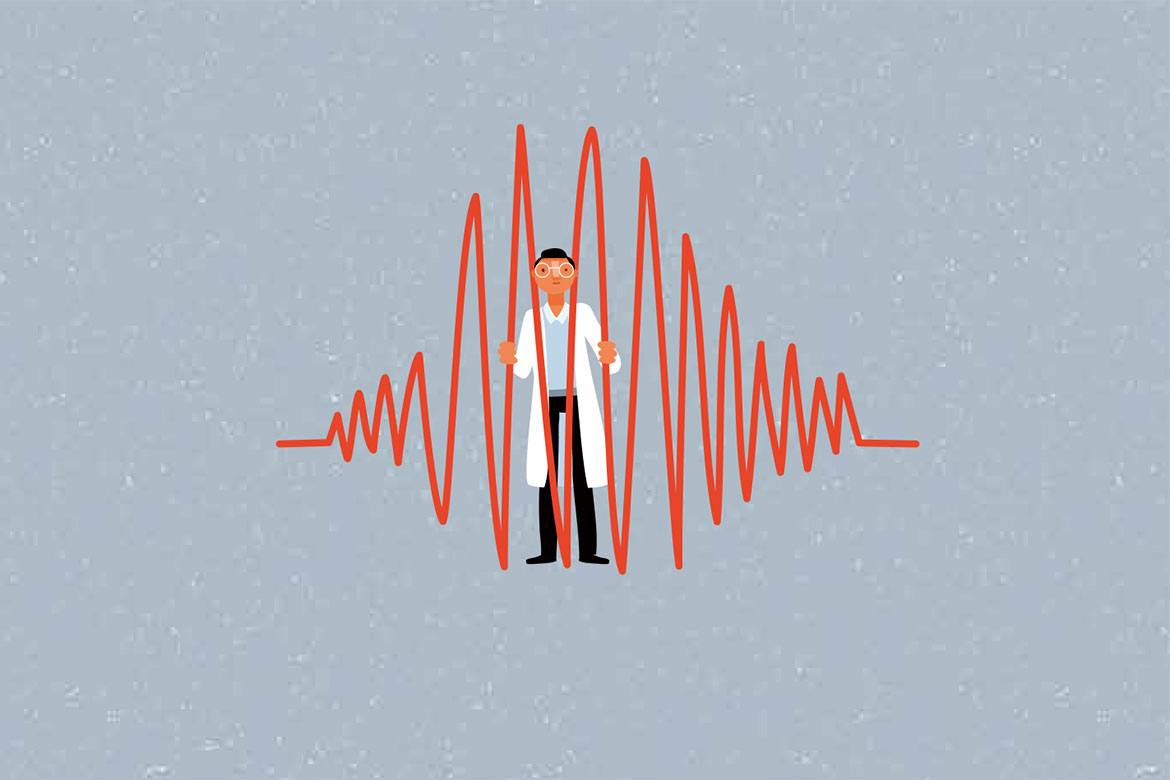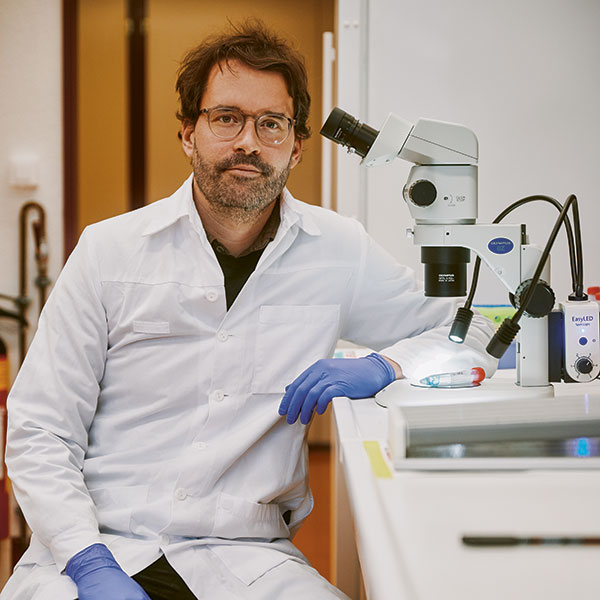DEBATTE
Müssen Labore für gefährliche Virenforschung mehr reguliert werden?

Foto: ZVG

Foto: ZVG
Die virologische Forschung hat unbestreitbare Erfolge erzielt. Impfstoffe gegen Polio, Masern und – in Rekordzeit entwickelt – gegen Covid-19 haben Millionen Leben gerettet. Ohne sich aufopfernde Forschende, die in Hochsicherheitslaboren mit gefährlichen Erregern arbeiten, wären diese Durchbrüche unmöglich gewesen. Doch Forschung, die Leben rettet, kann zugleich Leben gefährden. Allein zwischen 2000 und 2021 wurden weltweit über 300 Laborinfektionen mit 51 verschiedenen Erregern und acht Todesfällen dokumentiert.
Viele Laborunfälle bleiben unerfasst – eine systematische Unfallstatistik fehlt. Besorgniserregend sind gewisse sogenannte Gain-of-function- Experimente, bei denen Viren gezielt gefährlicher gemacht werden. Dabei bleibt unklar, ob die gefährlichere Variante in der Natur jemals auftreten wird, während gleichzeitig stets ein sehr hohes Risiko besteht. Laut Harvard- Professor Marc Lipsitch können bei der Freisetzung eines solchen Influenzavirus potenziell zwei Millionen bis 1,4 Milliarden Menschen sterben.
Mit synthetischer Biologie und mit KI wird Biotechnologie zur Ingenieurskunst. Laut WHO können selbst ausgestorbene Viren wie die Pocken rekonstruiert werden. Gleichzeitig werden in der Schweiz Hochsicherheitslabore teilweise jahrelang nicht kontrolliert. National- und Bundesrat haben 2023 eine Überprüfung der Aufsicht und der Kontrolle von Hochsicherheitslaboren beauftragt. Dabei leisten kantonale Behörden Grosses – doch ihnen fehlen oftmals die Ressourcen. Was ist also zu tun? Erstens: obligatorische Kurse für alle Biosicherheitsbeauftragten. Zweitens: ein sanktionsfreies Meldesystem mit transparenter Statistik – wie in Kanada. Drittens: ein unabhängiges nationales Biosicherheitsinspektorat – wie im Nuklearbereich.
Solche Massnahmen stärken das Vertrauen in die Virenforschung und sind in andern Risikobereichen bereits umgesetzt. Zum Beispiel werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Flughafen Zürichs auf ihre Zuverlässigkeit überprüft. Sicherheit und Forschung sind kein Widerspruch. Warum den Fortschritts-Fünfer gegen das Sicherheits-Weggli eintauschen, wenn in der Virenforschung beides zusammengehört? Ein einziger Unfall kann das Vertrauen zerstören und weitere Erfolge verunmöglichen.
Laurent Bächler ist Programmleiter für Biosicherheit beim Thinktank Pour Demain. Er vermittelt evidenzbasierte Vorschläge für eine resiliente Gesellschaft im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik.
In der teilweise stark vereinfachten und polarisierten Diskussion etwa um Gain-offunction- Experimente bekommt man schnell den Eindruck, dass Virologinnen und Virologen willkürlich mit hochpathogenen Erregern arbeiten und diese noch gefährlicher machen wollen. Im Forschungsalltag haben diese Versuche aber einen hohen Stellenwert. Sie liefern uns beispielsweise Erkenntnisse zur krankheitsauslösenden Wirkung von Viren, die künstlich resistent gegenüber Medikamenten gemacht wurden.
«Wie passt sich ein Virus an einen neuen Wirt an, und ist es in diesem noch genauso gefährlich?», ist eine wichtige Frage in den Anfängen einer neuen Pandemie, die wir nur zu einem kleinen Teil verstehen. Man kann diese Informationen nur bedingt aus Computermodellen oder Experimenten mit weniger gefährlichen Erregern ziehen, weil Letztere sich oft anders verhalten.
Das heisst natürlich nicht, dass es in der virologischen Forschung zugeht wie im Wilden Westen. Forschungsarbeiten mit hochpathogenen Erregern bedürfen in der Schweiz einer Genehmigung, bei der die Projekte erst nach abschliessender Überprüfung des Risikos durch eine unabhängige Expertenrunde freigegeben werden. Dies geschieht zentral auf nationaler Ebene, was eine Harmonisierung der Sicherheitsstandards in der Schweiz erlaubt. Das ist ein Vorteil gegenüber institutionellen Biosicherheitskomitees, wie sie in den USA üblich sind. Eine ausführliche Risikoabschätzung wird bereits bei der Beantragung des Projekts eingefordert.
Labore müssen so ausgestattet und Abläufe so standardisiert sein, dass das Risiko einer unabsichtlichen Freisetzung oder einer Infektion von Mitarbeitenden minimiert ist. So werden die sicherheitsrelevanten Elemente eines Hochsicherheitslabors regelmässig und unabhängig überprüft. Dazu zählen zum Beispiel die Abluftfiltration oder die Sterilisatoren für die Abfallbehandlung. Labormitarbeitende absolvieren ein überwachtes Training, bevor sie selbstständig experimentieren dürfen, und werden regelmässig nachgeschult. Ich bin überzeugt: Das Regelwerk und die kombinierte Überwachung durch Bund, Kantone und Betreiber in der Schweiz erlauben eine sichere Forschung. Eine Forschung, die letztlich der Sicherheit der Bevölkerung dient.
Mirco Schmolke ist Professor für Virologie an der Universität Genf. Er hat in Deutschland, den USA und der Schweiz mit hochpathogenen Viren gearbeitet.

Foto: ZVG
Die virologische Forschung hat unbestreitbare Erfolge erzielt. Impfstoffe gegen Polio, Masern und – in Rekordzeit entwickelt – gegen Covid-19 haben Millionen Leben gerettet. Ohne sich aufopfernde Forschende, die in Hochsicherheitslaboren mit gefährlichen Erregern arbeiten, wären diese Durchbrüche unmöglich gewesen. Doch Forschung, die Leben rettet, kann zugleich Leben gefährden. Allein zwischen 2000 und 2021 wurden weltweit über 300 Laborinfektionen mit 51 verschiedenen Erregern und acht Todesfällen dokumentiert. Viele Laborunfälle bleiben unerfasst – eine systematische Unfallstatistik fehlt. Besorgniserregend sind gewisse sogenannte Gain-of-function- Experimente, bei denen Viren gezielt gefährlicher gemacht werden. Dabei bleibt unklar, ob die gefährlichere Variante in der Natur jemals auftreten wird, während gleichzeitig stets ein sehr hohes Risiko besteht. Laut Harvard- Professor Marc Lipsitch können bei der Freisetzung eines solchen Influenzavirus potenziell zwei Millionen bis 1,4 Milliarden Menschen sterben.
Mit synthetischer Biologie und mit KI wird Biotechnologie zur Ingenieurskunst. Laut WHO können selbst ausgestorbene Viren wie die Pocken rekonstruiert werden. Gleichzeitig werden in der Schweiz Hochsicherheitslabore teilweise jahrelang nicht kontrolliert. National- und Bundesrat haben 2023 eine Überprüfung der Aufsicht und der Kontrolle von Hochsicherheitslaboren beauftragt. Dabei leisten kantonale Behörden Grosses – doch ihnen fehlen oftmals die Ressourcen. Was ist also zu tun? Erstens: obligatorische Kurse für alle Biosicherheitsbeauftragten. Zweitens: ein sanktionsfreies Meldesystem mit transparenter Statistik – wie in Kanada. Drittens: ein unabhängiges nationales Biosicherheitsinspektorat – wie im Nuklearbereich. Solche Massnahmen stärken das Vertrauen in die Virenforschung und sind in andern Risikobereichen bereits umgesetzt. Zum Beispiel werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Flughafen Zürichs auf ihre Zuverlässigkeit überprüft. Sicherheit und Forschung sind kein Widerspruch. Warum den Fortschritts-Fünfer gegen das Sicherheits-Weggli eintauschen, wenn in der Virenforschung beides zusammengehört? Ein einziger Unfall kann das Vertrauen zerstören und weitere Erfolge verunmöglichen.
Laurent Bächler ist Programmleiter für Biosicherheit beim Thinktank Pour Demain. Er vermittelt evidenzbasierte Vorschläge für eine resiliente Gesellschaft im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik.

Foto: ZVG
In der teilweise stark vereinfachten und polarisierten Diskussion etwa um Gain-offunction- Experimente bekommt man schnell den Eindruck, dass Virologinnen und Virologen willkürlich mit hochpathogenen Erregern arbeiten und diese noch gefährlicher machen wollen. Im Forschungsalltag haben diese Versuche aber einen hohen Stellenwert. Sie liefern uns beispielsweise Erkenntnisse zur krankheitsauslösenden Wirkung von Viren, die künstlich resistent gegenüber Medikamenten gemacht wurden. «Wie passt sich ein Virus an einen neuen Wirt an, und ist es in diesem noch genauso gefährlich?», ist eine wichtige Frage in den Anfängen einer neuen Pandemie, die wir nur zu einem kleinen Teil verstehen. Man kann diese Informationen nur bedingt aus Computermodellen oder Experimenten mit weniger gefährlichen Erregern ziehen, weil Letztere sich oft anders verhalten.
Das heisst natürlich nicht, dass es in der virologischen Forschung zugeht wie im Wilden Westen. Forschungsarbeiten mit hochpathogenen Erregern bedürfen in der Schweiz einer Genehmigung, bei der die Projekte erst nach abschliessender Überprüfung des Risikos durch eine unabhängige Expertenrunde freigegeben werden. Dies geschieht zentral auf nationaler Ebene, was eine Harmonisierung der Sicherheitsstandards in der Schweiz erlaubt. Das ist ein Vorteil gegenüber institutionellen Biosicherheitskomitees, wie sie in den USA üblich sind. Eine ausführliche Risikoabschätzung wird bereits bei der Beantragung des Projekts eingefordert. Labore müssen so ausgestattet und Abläufe so standardisiert sein, dass das Risiko einer unabsichtlichen Freisetzung oder einer Infektion von Mitarbeitenden minimiert ist. So werden die sicherheitsrelevanten Elemente eines Hochsicherheitslabors regelmässig und unabhängig überprüft. Dazu zählen zum Beispiel die Abluftfiltration oder die Sterilisatoren für die Abfallbehandlung. Labormitarbeitende absolvieren ein überwachtes Training, bevor sie selbstständig experimentieren dürfen, und werden regelmässig nachgeschult. Ich bin überzeugt: Das Regelwerk und die kombinierte Überwachung durch Bund, Kantone und Betreiber in der Schweiz erlauben eine sichere Forschung. Eine Forschung, die letztlich der Sicherheit der Bevölkerung dient.
Mirco Schmolke ist Professor für Virologie an der Universität Genf. Er hat in Deutschland, den USA und der Schweiz mit hochpathogenen Viren gearbeitet.