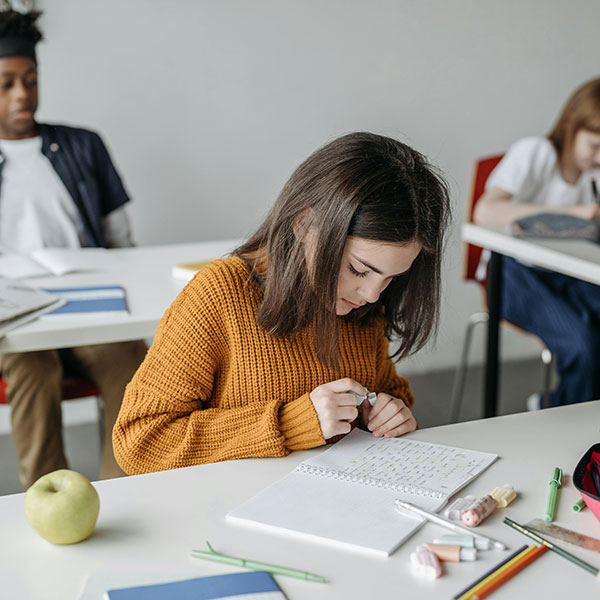Eine Forschungsnomadin schlägt Wurzeln
Die Biologin Gisou van der Goot ist auf vier Kontinenten gross geworden, wechselt in der Forschung gerne von Thema zu Thema und prägt nun die Life Sciences an der EPFL.

Was Gisout van der Goot an der Biologie liebt: Das Suchen und Hinterfragen. | Bild: Valérie Chételat
«In den Naturwissenschaften gibt es die Forschenden, die während Jahren fokussiert auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten. Dann gibt es andere, die lieber von einem Thema zum nächsten fliegen und die ich Bestäuber nenne», sagt Gisou van der Goot und lacht. «Ich selber gehöre zur zweiten Kategorie.» Im Übrigen verlässt sich die EPFL-Professorin auf ihre Intuition, womit sie bisher erfolgreich war: Sie hat prestigeträchtige Preise für ihre Forschung über Zellbiologie erhalten und gehört zum kleinen Zirkel der Dekane an der Lausanner Hochschule.
Die ausgebildete Ingenieurin, aus der inzwischen eine Biologin geworden ist, sieht sich als Nomadin der Forschung. Was ein solches Leben mit sich bringt, hat sie früh erfahren: Sie hat niederländische Wurzeln, ist aber in Iran, Ägypten, Indonesien und den USA aufgewachsen. Weil ihr Vater als Agrarökonom für die Uno arbeitete, ist sie fast alle zwei Jahre umgezogen. Sie besuchte jeweils französische Schulen und entschied sich als «Mathe-Freak» für ein Ingenieurstudium in Paris. Als sie das Diplom in der Tasche hatte, hörte sie auf ihre innere Stimme, die ihr zuflüsterte, dass sie es «mit 40 bedauern werde, wenn sie nicht den Weg der Forschung einschlägt». Deshalb nahm sie eine Dissertation in molekularer Biophysik in Angriff.
Vorurteil: Rabenmutter
Doch ihr Pariser Labor empfindet sie als «wenig inspirierend» und lanciert einen zweiten Versuch für einen Postdoc – am Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) in Heidelberg. «Dort habe ich entdeckt, was Forschung ist. Das Institut ist ein wahrer wissenschaftlicher Ameisenhaufen, in dem ich innert kurzer Zeit vielfältige Erfahrungen machen konnte. Hier fühlte ich mich am richtigen Platz.» Van der Goot trifft dort ihren späteren Ehemann, der heute Professor für Biochemie an der Universität Genf ist, und es bestätigt sich, dass die Biologie sie mehr fasziniert als die Ingenieurwissenschaft. «Als Ingenieurin versuche ich, relativ genau definierte Probleme zu lösen. Biologen dagegen leben in einer Art dauerhafter existenzieller Krise. Man weiss nie, ob man sich die richtige Frage stellt.» Ist das nicht beängstigend? Ganz im Gegenteil: «Ich mag diese Suche und das Hinterfragen.»
Van der Goot erforscht seit mehreren Jahrzehnten die biologische Grundeinheit: die Zelle. «Sie speichert verschiedenste Informationen und verarbeitet sie wie eine Art Minihirn, das bis heute Rätsel aufgibt. Das fasziniert mich.» Ihr mäandrierender «Wissenschaftsfluss» hat sie auch zur Leidenschaft für die Beziehung zwischen «Wirt und Krankheitserreger» getragen: Sie erforscht mehrere bakterielle Toxine, die Proteine als Eintrittspforte in den Körper nutzen.
Die Gesellschaft habe ihre Begeisterung für die Forschung nicht immer geteilt, sagt die Dekanin der Fakultät für Life Sciences der EPFL. «Es ist in der Schweiz nicht einfach, als Mutter Karriere zu machen.» Sie erinnert sich an den Tag, als sie sich der Mutter einer Kameradin ihrer Tochter vorstellte und diese antwortete: «Ich weiss, wer Sie sind: Die Mutter, die nie da ist. Diese Kritik hat mich getroffen. Auch wenn man versucht, sich eine dicke Haut zuzulegen, ist das hart.» Auch ihr Sohn fragte sie, weshalb sie nicht wie alle anderen Mütter sei, sondern so häufig reisen müsse.
«Damals habe ich erfahren, wie wichtig Auszeichnungen sein können», scherzt sie. 2009 erhält sie nämlich Schlag auf Schlag den Leenaards- und den Marcel-Benoist- Preis. «Plötzlich erklärte eine höhere Instanz – die Medien, auch die lokalen –, dass meine Arbeit die Entbehrungen wert sei. Das hat mein Privatleben verändert, auch die Wahrnehmung meiner Arbeit durch meine Kinder, ihre Lehrpersonen und andere Eltern.»
Schon im Ingenieurstudium war Van der Goot es gewohnt, als Frau einer Minderheit anzugehören. Doch nie zuvor hatte sie so viele genderspezifische Vorurteile gespürt wie nach ihrer Ernennung zur Dekanin. Sie empfand diese «als Ohrfeige». «In Sitzungen dachten die Personen, die mich nicht kannten, dass ich da war, um das Protokoll aufzunehmen. Eigentlich kann ich ihnen deswegen nicht böse sein, statistisch gesehen gibt es wenig Frauen in Führungspositionen. » Die 55-Jährige versucht nun in ihrer Fakultät, Frauen und Eltern die Berufstätigkeit zu erleichtern, insbesondere als Mentorin von jungen Forscherinnen.
Ein weiteres Anliegen Van der Goots ist der Klimawandel. Sie will ihre Kolleginnen und Kollegen dazu aufrufen, weniger Langstreckenflüge zu machen. «Wir alle sollten versuchen, unseren CO2-Fussabdruck zu reduzieren.»
Die Biologin hat nicht die Absicht, für immer im Dekanat zu bleiben. «Nach meiner zweiten Amtszeit, wenn ich die Restrukturierungen und Professionalisierung gewisser Funktionen abgeschlossen habe, werde ich aufhören.» Die Nomadin ist aber sesshaft geworden: «Ich werde nicht mehr weiterziehen! Ab einem gewissen Alter sollte man nicht mehr den Ort wechseln, denn mit einem sozialen Netz lebt man längerfristig am besten. Wurzeln werden im Alter wichtiger.» Eine Überzeugung, die sie dazu bewogen hat, Führungspositionen in prestigeträchtigen Institutionen im Ausland abzulehnen. «Ohne zu zögern. Die müssen denken, ich sei verrückt», sagt sie.
Doch das Interesse an fernen Ländern, insbesondere am Mittleren Osten, ist geblieben, ein Traumziel Van der Goots ist Afghanistan. Ihre Arbeit und Ferien geben ihr da aber genug. «Das Forschungsumfeld ist für mich ideal: Ich treffe viele Leute und reise, muss dafür aber nicht ständig den Wohnort wechseln. In der Schweiz kann ich in einem Dorf mit 1000 Menschen leben und gleichzeitig Spitzenforschung betreiben. Das ist ein Luxus.» So findet sie das – fast – perfekte Gleichgewicht.