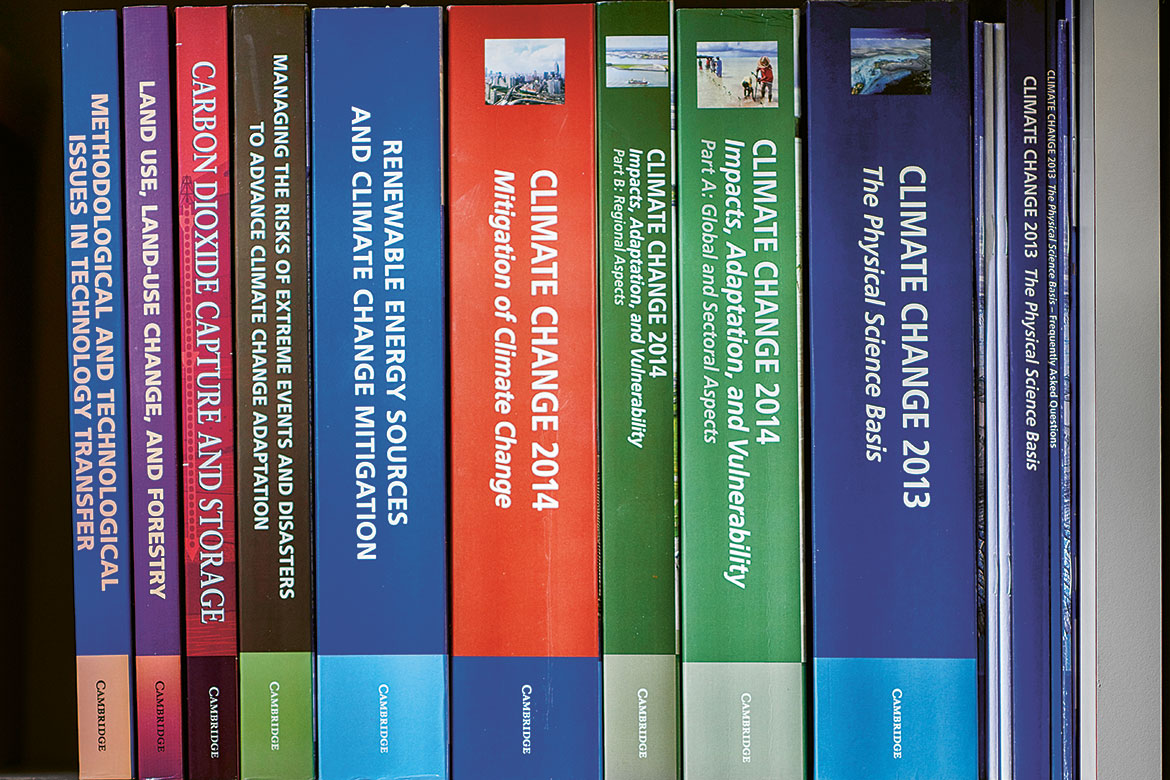Fokus: Forschung aus Betroffenheit
Editorial: Alle sind voreingenommen
Was, du bist persönlich betroffen und forschst dazu? Das ist voll OK, findet Judith Hochstrasser, Co-Redaktionsleiterin von Horizonte.

«Es gibt so manche Fallstricke, will man die persönlichen Erfahrungen der Forschenden in Verbindung mit dem Anspruch an Objektivität verstehen», sagt Co-Redaktionsleiterin Judith Hochstrasser. | Photo: Angelika Annen, Styling / Hair & Make-up: Amanda Brooke, Model: Iva von Option Model Agency
Für diese Ausgabe suchten wir Forschende, die von ihrem Untersuchungsgegenstand persönlich betroffen sind. Dazu gehört die Erziehungswissenschaftlerin mit algerischer Familiengeschichte, die zu antimuslimischem Rassismus hierzulande forscht und diesen am eigenen Leib erlebt hat. Sie und vier weitere Forschende erzählen offen, wie sie mit solchen Überschneidungen umgehen. Wir hatten ursprünglich noch andere Personen angefragt, die in ihrem Leben schwierige persönliche Erfahrungen gemacht haben und jetzt dazu forschen. Dabei ernteten wir auch ablehnende Antworten mit Vorwürfen. Sie lauteten zusammengefasst etwa so: Die Redaktion ginge implizit davon aus, dass im globalen Süden weniger objektiv geforscht würde. Oder sie stigmatisiere Menschen, die schon von der Gesellschaft diskriminiert würden.
Die Person, die aus dem globalen Süden kommt und dort auch forscht, war unter unseren Anfragen eine Ausnahme. Daher war ihre Vermutung, dass wir speziell Forschung aus dieser Region der Voreingenommenheit verdächtigen, rasch widerlegt. Dass dagegen jemand, der diskriminierte Gruppen untersucht und selbst dieser Gruppe angehört, besonders intensiv über professionelle Distanz und unbewusste Voreingenommenheit nachdenkt, davon gingen wir tatsächlich aus – jedoch als Pluspunkt. Die ablehnenden Reaktionen zeigen jedenfalls: Es gibt so manche Fallstricke, will man die persönlichen Erfahrungen der Forschenden in Verbindung mit dem Anspruch an Objektivität verstehen. Das fängt schon beim Begriff der Betroffenheit an, wie etwa der Historiker Tobias Urech erklärt. Und das geht weiter mit der vielbeschworenen Objektivität, von der es eben mehr als eine gibt, wie Philosoph Jan Sprenger uns lehrt.
Das Publikum bewertet übrigens persönlich gefärbte Forschung dann als besonders glaubwürdig, wenn es dem Thema grundsätzlich zustimmt. Es ist dagegen umso misstrauischer, wenn die Ergebnisse nicht zu den eigenen Überzeugungen passen. Kurz gesagt: Die eigene Voreingenommenheit beeinflusst das Urteil über Forschung. So oder so hilft glücklicherweise eine Kernkompetenz der Wissenschaft auch die eigenen Voreingenommenheiten aufzulösen: transparente Reflexion.