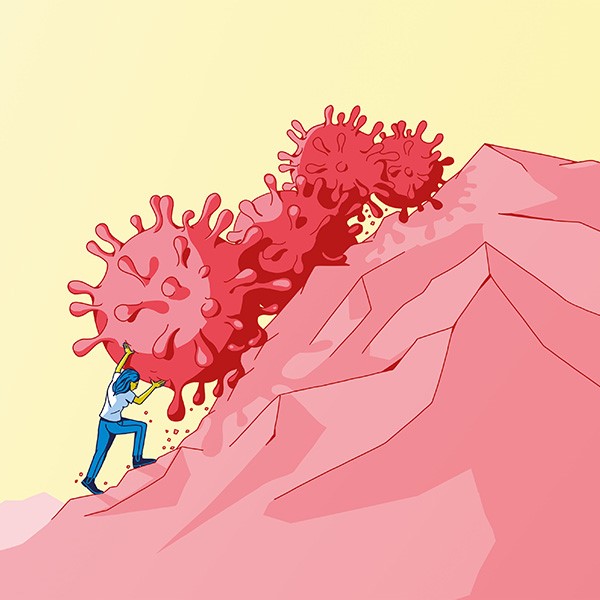INFEKTIONSKRANKHEITEN
Nach der Pandemie ist vor der Pandemie
Auf die schnelle Ausbreitung des Coronavirus war die Welt schlecht vorbereitet. Wie es die Schweiz das nächste Mal besser machen kann.

Bringt die Vogelgrippe die neue Pandemie bei Menschen? Auch Forschende können das nicht voraussagen, aber sie können sich auf den Fall vorbereiten. | Foto: Keystone / Magnum Photos / Cristina de Middel
«Klar ist, dass wieder eine Pandemie kommt. Die Frage ist nur, wie viel Zeit bis dahin vergeht», sagt Kaspar Staub. Es deute sich aber an, dass der Abstand zwischen den Ereignissen immer kürzer wird. Der Historiker und Epidemiologe beschäftigt sich am Institut für Evolutionäre Medizin der Universität Zürich unter anderem mit vergangenen Pandemien.
Und der nächste Erreger könnte sein …
Pathogen X – so nennen Fachleute den noch unbekannten Auslöser der nächsten Pandemie. Als Kandidaten sind neben bekannten Grippe- und Coronaviren auch weniger bekannte Erreger im Gespräch, etwa das in Mäusen verbreitete Hantavirus. Ebenfalls möglich: ein ganz neues, bislang unbekanntes Pathogen.
Die nächste Pandemie wird wohl eine Zoonose sein, die vom Tier zum Menschen springt, darin sind sich die meisten einig. Die grösste Gefahr geht von respiratorischen Viren aus, die wie Sars-Cov-2 durch die Luft übertragen werden und nicht wie etwa die Affenpocken durch Hautkontakt. Für einige dieser Viren werden Fälle nachverfolgt oder das Erbgut sequenziert, um für den Menschen gefährliche Mutationen rechtzeitig zu erkennen. «Wir haben aber nicht die Kapazität, alle Viren grossflächig zu überwachen», so Virologin Silke Stertz von der Universität Zürich.
Momentan oben auf der Sorgenliste ist die Vogelgrippe, die in den USA auf Kühe übergesprungen ist. Auch einige Menschen haben sich infiziert. Stertz gibt eine vorläufige Entwarnung: Die Ansteckung sei nur durch eine hohe Dosis an Viren bei engem Kontakt mit Kühen möglich. Das Virus weise noch keine Mutationen auf, die eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung ermöglichen. «Das heisst aber nicht, dass diese Anpassung nicht irgendwann passiert.»
Seine Forschung belegt: Während einer Massenerkrankung gibt es in der Schweiz wenig Probleme, Aufmerksamkeit und Ressourcen für deren Bekämpfung zu generieren. Doch kaum ist die Krise vorbei, wird es schwieriger. Katastrophenlücke wird diese kollektive Vergesslichkeit in der Fachwelt genannt. Natürlich sei es verständlich, dass Menschen nicht in ständiger Alarmbereitschaft leben, so Staub. «Aber gerade deshalb müssen wir jetzt eine Wissensbasis und Ressourcen schaffen.» Wenn die nächste Pandemie komme, stünden dann gewisse Grundlagen parat.
Schon während der Covid-19-Pandemie begann sich die Epidemiologin Nicola Low mit ihrem Team an der Universität Bern für die nächste vorzubereiten. Denn damals zeigten sich deutliche Wissenslücken. «Wir wussten zum Beispiel nicht, wie viel Kontakt Menschen in der Schweiz im alltäglichen Leben miteinander haben», so Low. Solche Daten sind wichtig, etwa um Ansteckungswege zu modellieren. Die Modelle bieten eine Entscheidungsgrundlage für sinnvolle Massnahmen: Hilft eine Maskenpflicht tatsächlich? Ist die Schliessung von Schulen wirklich nötig?
Eine Kohorte für den Notfall bereit
«Ohne eine Basislinie sind wir im Blindflug», erklärt Low. Deshalb hat das Team nun am Multidisciplinary Center for Infectious Diseases mit Unterstützung der Schweizer Stiftung Vinetum die europaweit einzige Kohortenstudie initiiert, deren Fokus auf der Vorbereitung liegt. An Beready sollen 1500 Haushalte im Kanton Bern teilnehmen. Nach einer Erstuntersuchung sammeln die Forschenden die Daten durch Fragebögen zu bestimmten die Teilnehmenden selbst mit Fingerpicks nehmen und einschicken. So lässt sich beispielsweise verfolgen, wie sich verschiedene Infektionskrankheiten innerhalb einer Fa milie verbreiten. Auch Haustiere sind dabei: Krankheitserreger springen oft vom Tier auf den Menschen über und umgekehrt.
Zudem soll die Berner Kohorte im Fall einer Pandemie als eine Art schnelle Einsatztruppe dienen. Das Team hätte schon eine gut charakterisierte Gruppe an Teilnehmenden, um wichtige Zusammenhänge fast in Echtzeit zu ermitteln. Etwa, ob bereits im Blut vorhandene Antikörper vor dem neuen Erreger schützen.
Doch nicht nur menschliche Faktoren gilt es besser zu verstehen. Auch über die Krankheitserreger ist noch zu wenig bekannt. So hatte bei Covid-19 zunächst niemand damit gerechnet, dass Infizierte schon so lange vor dem Auftreten von Symptomen ansteckend sein können. Bei der Grippe – auf die Schweizer Pandemiepläne ausgerichtet waren – ist diese Zeitspanne kürzer. Und auch die unerwartet effektive Verbreitung durch die Luft trug zur schnellen Verbreitung von Sars-Cov-2 bei. «Eine Infektion durch Aerosole ist sehr schwer einzudämmen», sagt die Virologin Silke Stertz von der Universität Zürich. «Aber das Verständnis für diesen Prozess ist noch extrem gering.» Das mache es schwierig, wirksame Gegenmassnahmen zu entwickeln.
Schon vor der Covid-19-Pandemie entwickelte sie deshalb gemeinsam mit einem Team der EPFL und der ETH ein Testsystem, das infektiöse Tröpfchen generiert. Damit lassen sich die in einem Aerosol ablaufenden Prozesse untersuchen – zum Beispiel, welchen Effekt die Zusammensetzung der Umgebungsluft auf das Überleben von Viren hat. «Wenn wir das Prinzip verstanden haben, öffnen sich hoffentlich viele Wege für die Bekämpfung.»
Schneller zum Impfstoff
Die richtigen Gegenmassnahmen können am Anfang einer Pandemie helfen, das Tempo der Ausbreitung zu verlangsamen. Der beste Weg, sie ganz zu stoppen, ist jedoch eine Impfung. «Bei Sars-Cov-2 dauerte es 326 Tage von der Sequenzierung des Virus bis zur ersten Auslieferung des Impfstoffs. Das war unglaublich schnell», sagt Aurélia Nguyen, stellvertretende Geschäftsführerin der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi), einer NGO mit Sitz in Oslo. Wenn es nach dieser geht, soll bei der nächsten Massenerkrankung schon nach 100 Tagen ein Vakzin bereitstehen. «Das würde unzählige menschliche Leben retten und einen fundamentalen Unterschied für den Verlauf machen», so Nguyen. Der Plan ist ambitiös, zumal keiner weiss, durch welchen Erreger die nächste Pandemie ausgelöst werden wird (siehe Kasten oben).
Die Cepi verfolgt deswegen einen breiten Ansatz, um mithilfe von KI und anderen Methoden die gefährlichsten Virenfamilien zu identifizieren. Für bereits bekannte Vertreter dieser Familien pusht die NGO die Entwicklung von Gegenmitteln. «Im Falle einer Pandemie muss in diesen vorbereiteten Impfstoff dann nur noch der Baustein für das spezifische Virus eingesetzt werden», so Nguyen.
Andere Massnahmen sind die Vorbereitung von klinischen Studien, Absprachen mit regulatorischen Behörden sowie der Aufbau von Produktionsanlagen auf der ganzen Welt, auch im globalen Süden. «Wir setzen dabei nicht nur auf MRNA-Technologie», so Nguyen. Diese habe zwar viele Vorteile wie die schnelle Entwicklung und Produktion. Aber es gibt auch Limitationen. So braucht es dafür beispielsweise eine durchgehende Kühlkette.
Andersartige Impfstoffe bieten möglicherweise auch länger anhaltenden Schutz. Für vielversprechend hält Nguyen auch Forschung zu Immunisierungen, die gegen einen grossen Teil der Grippe, Coronaviren oder andere Familien wirken. Solche sogenannte Pan-Impfstoffe würden möglicherweise nicht immer optimal greifen, aber dennoch gut genug, bis ein spezifischer Impfstoff zur Verfügung steht.
Nicht mehr nur die Grippe
Alle Vorbereitungen nützen natürlich nur dann etwas, wenn sie im Falle einer Pandemie gendes Zeichen dafür ist laut Nguyen das WHO-Abkommen, das in diesem Jahr verabschiedet wurde. Darin verpflichten sich die Mitgliedsländer unter anderem zur Zusammenarbeit bei Lieferketten und zum Austausch von Informationen. Die Nationen dürfen aber weiterhin souverän über Massnahmen wie Lockdowns entscheiden.
Auch die Schweizer Regierung ist dabei, die Lehren aus der vergangenen Pandemie umzusetzen. Im Juli dieses Jahres wurde ein überarbeiteter nationaler Pandemieplan veröffentlicht. Dieser ist nicht mehr nur auf Grippe ausgerichtet wie der vorherige Plan, sondern auch auf respiratorische Viren im Allgemeinen. Neu ist zudem das Online-Format: Dieses soll es möglich machen, Aktualisierungen und Anpassungen laufend vorzunehmen.
Wie sehr neue wissenschaftliche Erkenntnisse tatsächlich in die Bekämpfung der nächsten Pandemie einfliessen werden, muss sich erst noch zeigen. «Wir können Daten generieren, aber was damit gemacht wird, entscheidet letztendlich die Politik», sagt Eva Maria Hodel, Projektmanagerin der BereadyStudie. Ihr Team arbeitet jedenfalls daran, schon jetzt mit Entscheidungsträgern in den Dialog zu treten und Kontakte aufzubauen.