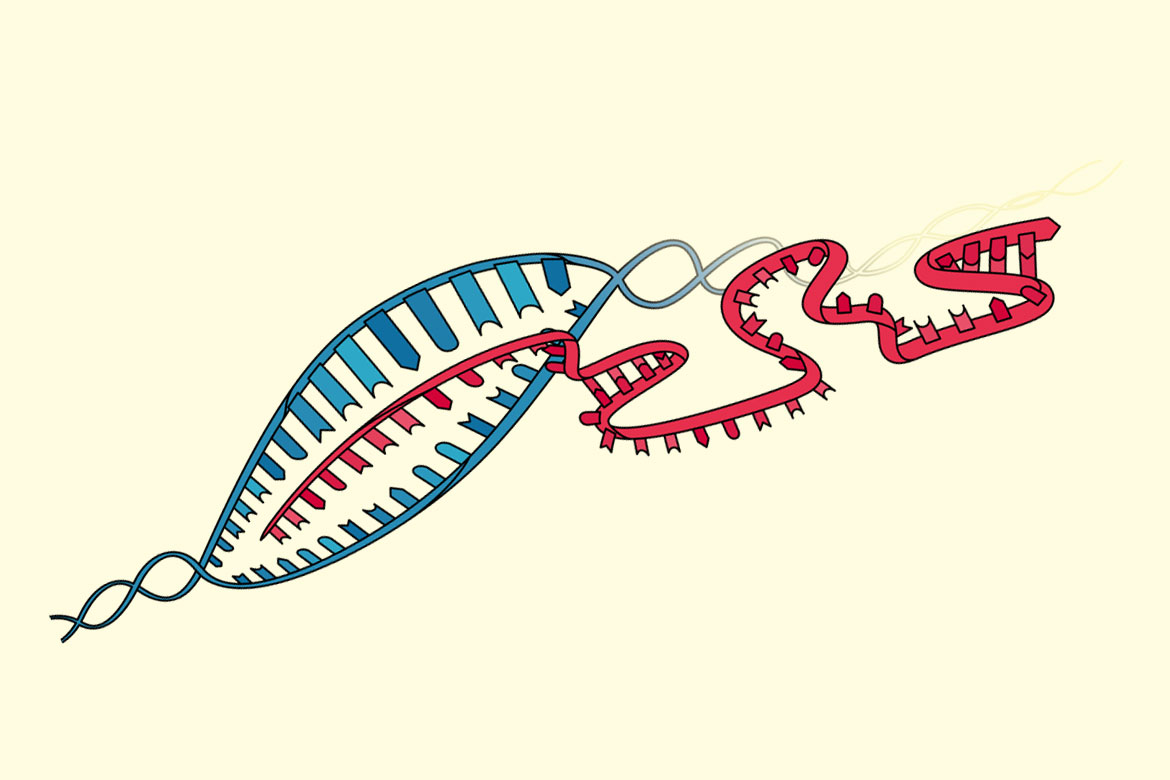ARRMUTSFORSCHUNG
Oliver Hümbelin: «Die Sozialhilfe sammelt ungelöste Probleme»
Armut wird für immer mehr Menschen zur Realität, besonders seit Beginn der Pandemie. Der Sozialwissenschaftler Oliver Hümbelin von der Berner Fachhochschule über weitere Ursachen und wirkungsvolle Politik.

Nicht alle Menschen in der Schweiz haben genug Geld - die Forschung von Sozialwissenschaftler Oliver Hümbelin trägt zur Verbesserung der Datenlage zur Untersuchung von Ungleichheiten bei. | Foto: Ruben Hollinger
Oliver Hümbelin, jede zwölfte Person bei uns gilt als arm. Wohin müssen wir den Blick richten, um die Armut zu sehen?
Wir Sozialforschende sehen sie zum einen in den Statistiken und Daten, die wir analysieren. Dort zeigt sich, wie viele Menschen unter der Armutsgrenze leben oder Sozialhilfe beziehen. Mit der Coronakrise wird die Armut aber auch stärker im öffentlichen Leben sichtbar. Etwa wenn Menschen in Genf oder Zürich für Lebensmittelpakete anstehen. Es gibt auch in der Schweiz viele Leute, für die der Alltag einen Überlebenskampf darstellt. Auch wenn sie nicht gezwungen sind, draussen zu schlafen oder betteln zu gehen.
Wann gilt man hierzulande als arm?
Im Jahr 2018 lag die Armutsgrenze gemäss der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) bei durchschnittlich 2286 Franken pro Monat für eine Einzelperson und 3968 Franken pro Monat für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren. Nach Abzug der Wohnkosten und Krankenkassenprämien bleibt da nicht mehr viel übrig. Unter dem Strich geht es immer um Menschen, die keinen oder nur einen prekären Anschluss an den Arbeitsmarkt haben. Deshalb ist es so wichtig, dass möglichst alle zu fairen Bedingungen am Arbeitsleben teilhaben können.
Seit einigen Jahren bekommt Armut in der Schweiz mehr Aufmerksamkeit. Das zeigt sich in Medien, aber auch in politischen Diskussionen. Nimmt die Armut bei uns zu?
Das Bewusstsein in breiten Teilen der Bevölkerung nimmt zu, dass Armut auch sie treffen kann. In einem Krisenjahr wie diesem gilt das besonders. Die Armutsquote ist über die vergangenen Jahre wieder leicht gestiegen. Die Quote der Sozialhilfebeziehenden dagegen bleibt etwa konstant. Das könnte darauf hindeuten, dass die Zahl von Armutsbetroffenen zunimmt, die keine Sozialhilfe beziehen. Für eine gesicherte Aussage fehlen jedoch die Zahlen.
Welche Faktoren erhöhen das Armutsrisiko?
In einer im vergangenen Herbst publizierten Studie konnte ich zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen zeigen, dass Menschen mit Kleinkindern ein erhöhtes Armutsrisiko haben, weil nach der Geburt viele Eltern ihr Pensum reduzieren. In Kombination mit der eher konservativen Familienpolitik in der Schweiz können Kinder so zu einem Armutsrisiko werden. Das gilt besonders für Alleinerziehende. Zudem wird es für Menschen ohne Bildungsabschlüsse immer schwieriger, am Arbeitsmarkt teilzuhaben. Einfache Tätigkeiten erledigen zunehmend Maschinen und Computer. Besonders gefährdet sind auch Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die von der IV abgelehnt wurden, und Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, wobei die Sprachbarriere oft eine Rolle spielt.
Sie haben 2019 auch eine Studie zur Frage veröffentlicht, in welchen Regionen das Armutsrisiko am höchsten ist.
Die Zahlen zeigen, dass es in den Städten am höchsten ist, dann kommt das Land und am Schluss die Agglomeration. Wir vermuten, dass das primär mit den unterschiedlichen Wirtschafts- und Sozialstrukturen zusammenhängt. Auf dem Land sind Armutsbetroffene eher einzelne Landwirte, die um ihre Existenz kämpfen. In den Städten finden sich viele Selbstständige mit unregelmässigen Einkünften, Ausländerinnen und Ausländer und Junge mit prekären Anstellungen. Ein interessanter Unterschied zeigt sich auch bei der Sozialhilfequote. Armutsbetroffene in den Städten beziehen deutlich häufiger Sozialhilfe als Armutsbetroffene auf dem Land. Es gibt Hinweise darauf, dass das mit der gesellschaftlichen Akzeptanz von Sozialhilfe zu tun hat, die in verschiedenen sozialen Milieus unterschiedlich ausgeprägt ist.
Caritas hat im vergangenen November von einer starken Zunahme von Armutsbetroffenen durch die Coronakrise gewarnt. Teilen Sie diese Befürchtung?
Die Situation ist besorgniserregend. Wir haben den stärksten Konjunktureinbruch seit 1975. Die Arbeitslosenquote ist von tiefen 2 Prozent auf 3,2 Prozent im Oktober 2020 gestiegen. Das sind 50 000 Personen mehr. 300 000 Menschen sind zudem in Kurzarbeit, wie es für sie weitergeht, wird sich erst noch zeigen. Es gab im Sommer insgesamt eine leichte Erholung, die durch die zweite Welle aber unterbrochen wurde. Menschen mit tiefem Einkommen werden stärker von diesen Entwicklungen betroffen sein. Corona verschärft die Ungleichheit.
Wie wirkt sich diese Lage auf die Sozialhilfe aus?
Bei der Sozialhilfe meldeten sich zu Beginn der ersten Welle vier Mal mehr Personen zu Erstberatungen als sonst. Viele wussten in der Krise nicht wohin. Die tatsächlichen Sozialhilfefälle sind bisher noch nicht gestiegen, auch weil der Bundesrat relativ schnell Massnahmen ergriffen hat. Wie stark die Fallzahlen noch steigen werden, wird auch davon abhängen, wie lange die Krise andauert und wie viele Betriebe in Konkurs gehen. Die SKOS prognostiziert einen Zuwachs bei der Sozialhilfe um zwischen 12 und 28 Prozent bis 2022.
Kann die Sozialhilfe einem solchen Zuwachs standhalten?
Die Sozialhilfe hat bereits ohne Pandemie eine schwierige Aufgabe. Sie ist ursprünglich zur Überbrückung in einer Notlage gedacht. Wie die Daten zeigen, verlässt tatsächlich ein Drittel der Beziehenden die Sozialhilfe innerhalb eines Jahres wieder. Der Anteil jener, die hängen bleiben, nimmt jedoch stetig zu. Das hat mit den steigenden Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt zu tun und mit der Verschärfung des Zugangs zur IV, wie eine Studie des Bundes kürzlich aufzeigte. Wenn nun tatsächlich so viele neue Fälle zur Sozialhilfe kommen, wie die SKOS befürchtet, wird das sehr herausfordernd. Es besteht die Gefahr, dass die Sozialhilfe immer mehr Aufgaben übernehmen muss, für die sie ursprünglich gar nicht gedacht war. Sie wird so zum Sammelbecken für ungelöste gesellschaftliche Probleme. Darüber müssen wir reden.
Der Bezug von Sozialhilfe wird oft stigmatisiert, die Armutsbetroffenen durch die Pandemie sind aber für alle offensichtlich nicht selber schuld an ihrem finanziellen Abstieg. Eine Chance für eine positivere Haltung gegenüber der Sozialhilfe?
Je mehr Menschen unverschuldet mit Sozialhilfe leben, desto positiver wird die gesellschaftliche Haltung gegenüber der Sozialhilfe? Also ich weiss nicht. Sind die Menschen, die sich jetzt da befinden, denn aus Selbstverschulden da? Das mögen gewisse Bevölkerungsgruppen so sehen, zahlreiche Studien zeigen, dass es doch recht viel komplexer ist. Ich vermute aber, die Krise hat tatsächlich dazu geführt, dass man in der Schweiz ganz allgemein den Wert eines Systems mit solidarischer Absicherung wahrnimmt. Ohne die staatliche Absicherung, also primär Instrumente wie Kurzarbeit und andere Massnahmen des Bundes, wäre ein Teil der Bevölkerung jetzt viel schlechter dran.