JUNGE MEINUNG
«Meine Arbeitsbewilligung ist an meinen Arbeitgeber gebunden»
Rita Sarkis stammt aus dem Libanon und entwickelt KI-Tools für Tumordiagnosen. Sie erzählt von den Hindernissen, denen Forschende aus Drittstaaten in der Schweiz gegenüberstehen.
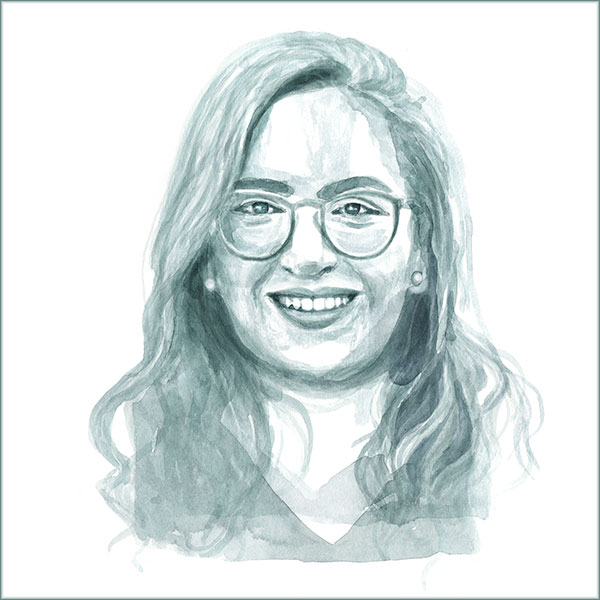
Rita Sarkis arbeitet in digitaler Pathologie und räumlicher Transkriptomik am Institut für Pathologie des Chuv. Sie war bis 2023 Präsidentin der Mittelbauvereinigung der EPFL. | Illustration: Stefan Vecsey
In meiner Forschung verbessern wir Tumordiagnosen mit KI-basierten Tools und solchen für die Visualisierung von Zellen und Geweben. Dazu braucht es hochspezialisiertes Fachwissen, das nur wenige haben. Als Wissenschaftlerin aus dem Libanon, einem Land, das nicht Mitglied der EU oder der Efta ist und damit als Drittstaat gilt, erlebe ich meine Arbeit in der Schweiz als wertvolle Chance, aber auch als hürdenreich – selbst nach einer akademischen Laufbahn an einer eidgenössischen Institution.
Meine Arbeitsbewilligung ist an meinen Arbeitgeber gebunden, weshalb jede Neuorientierung mit Unsicherheiten einhergeht. Die komplexe Bürokratie macht jeden Karriereschritt zu einer Herausforderung. Im Gegensatz zu Forschungsinstituten scheuen Spitäler die Mühen, Personen aus Drittstaaten einzustellen, obwohl sie in der Präzisionsmedizin an vorderster Front forschen. Für sie ist der Nachweis, dass die Stelle nicht mit einer Person aus der Schweiz besetzt werden kann, ein langwieriger und abschreckender Prozess.
Von den formalen Hürden abgesehen ist man in der Schweiz als Forscherin aus einem Drittstaat durch diesen Status unter ständigem Druck. Neben der prekären administrativen Situation besteht ein latentes Gefühl der Diskriminierung, das manchmal durch die Haltung von HR und Verwaltung noch verstärkt wird. Häufig bekommen wir zu hören, unsere Situation stelle für die Institution einen «Mehraufwand» dar. Als hätten wir unsere Anwesenheit eher einer Gefälligkeit zu verdanken als unserem legitimen Beitrag.
Forschende aus Drittstaaten gelangen über den Arbeitsmarkt nicht zu den Unternehmen, die ihre Kompetenzen benötigen. Damit werden ungleiche Chancen bei den Karriereaussichten geschaffen. Mehrere ehemalige Kollegen haben deswegen ihre Laufbahn nicht hier fortgesetzt, obwohl sie Angebote aus der Forschung hatten. Die Regulierungen stehen also in Widerspruch zum Bedarf des Forschungssektors, beschränken die Diversität, behindern die Innovation und erschweren technologische Fortschritte in Spitälern. Wenn die Schweiz wettbewerbsfähig für exzellente Forschung bleiben will, muss sie die Kriterien für die Anstellung von Forschenden aus Drittländern lockern.



