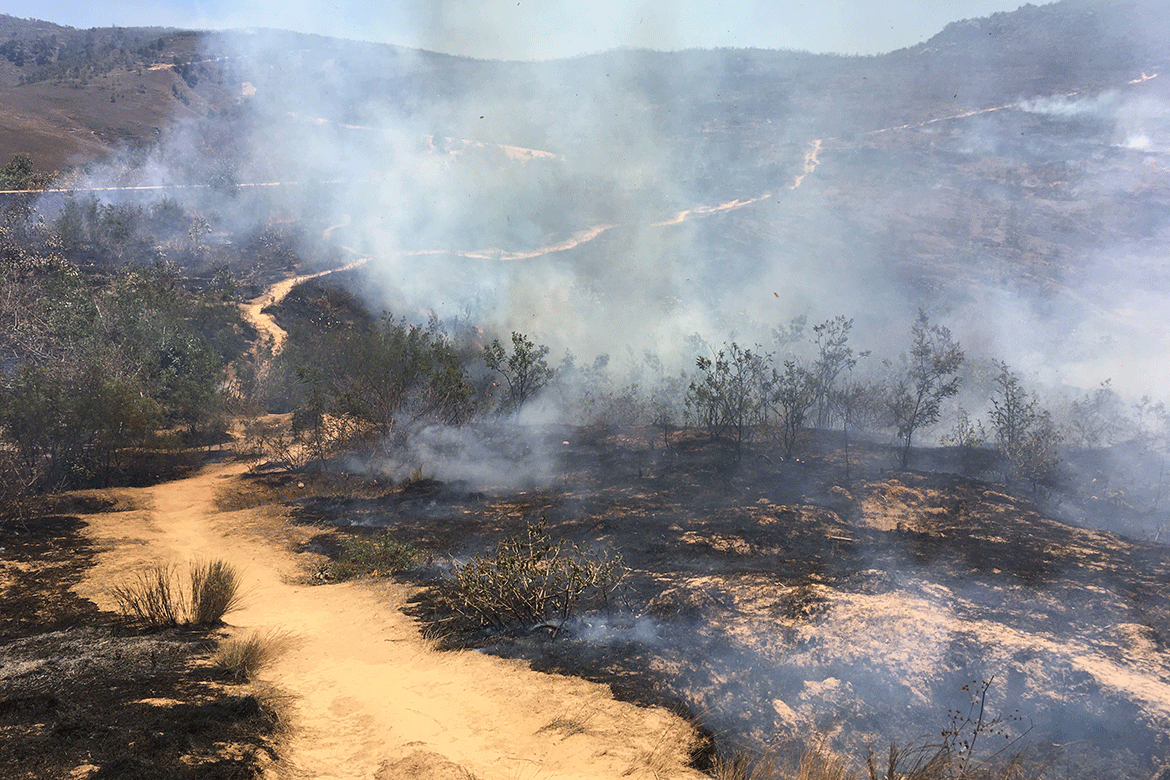REPORTAGE
Tropische Üppigkeit, bereit für kühle Analyse
Am Botanischen Garten Genf wird entschlüsselt, weshalb die Chemie zwischen Blüten und Bestäubern so genau stimmt. Diese erklärt auch die Vielfalt an Farben, die eine Pflanzengruppe allein für Kolibris entfaltet.

Rot und verlockend: Die Blüten von Aeschynanthus radicans aus den asiatischen Tropen warten darauf, von Singvögeln bestäubt zu werden. | Foto: Hervé Annen
Die Brillengläser des Botanikers Mathieu Perret beschlagen, als er die Tür zum Tropenhaus mit seinen feuchten 20 Grad Celsius aufstösst. Wir befinden uns in einer winzigen Nach-bildung des Atlantischen Regenwalds von Brasilien, eines der artenreichsten Lebensräume der Erde. In diesem Gewächshaus des Botanischen Gartens Genf wachsen mannshohe Sträucher auf Tuffsteinquadern, und von aufgehängten Rindenstücken strecken kleine, zarte Pflänzchen ihre roten Blüten herab. So unterschiedlich die Pflanzen rein äusserlich auch scheinen mögen, sie gehören alle zu ein und derselben Familie, den sogenannten Gesneriengewächsen.
Diese sind weltweit mit über dreitausend Arten in den Tropen verbreitet, von Australien bis nach Amerika. Als Zierpflanzen haben sie Berühmtheit erlangt und stehen heute in vielen Wohnzimmern. Die enorme Formen- und Farbenvielfalt ihrer Blüten hat sie auch zu einem begehrten Forschungsobjekt gemacht. «Wir wollen herausfinden, wie die Evolution so etwas zustande bringt», sagt Perret.
Auch bei Kolibris frisst das Auge mit
Der Forscher bleibt vor einem prächtigen Strauch stehen. Seine Blüten sehen aus wie leicht gebogene Röhren. «Die sind perfekt an den Schnabel eines Kolibris angepasst.» Die Staubblätter mit den Pollen sitzen auf langen Stielen und ragen einen halben Zentimeter aus den Blüten hervor. Wenn der Kolibri im Schwebeflug seinen Schnabel reinsteckt, berührt seine Stirn irgendwann die Staubblätter und wird eingepudert. Beim nächsten Busch überträgt er den Pollen auf das Fruchtblatt, das ebenfalls punktgenau auf die Stirn des Kolibris zeigt. «Dank dieser hochspezialisierten Blütenform funktioniert die Bestäubung möglichst zuverlässig», erklärt Perret.
Er pflückt eine der Blüten und bricht sie entzwei. Ein Tropfen aus dickflüssigem Nektar quillt hervor. «Das ist die Belohnung für die Vögel und sorgt dafür, dass sie immer wieder zurückkehren.» Jetzt braucht es nur noch einen Wegweiser, dem die Kolibris folgen können: die Farbe. «Das leuchtende Rot der Blüte entspricht genau der Wellenlänge, die Kolibris gut mit ihren Augen wahrnehmen.»
Perret hat die Blütenfarbe von mehr als 150 Gesneriengewächsen ermittelt und verglichen, wie gut diese mit den Augen von Kolibris und anderen Bestäubern wie etwa den Wildbienen wahrgenommen werden können. Fazit: In den meisten Fällen passen die beiden Spektren wie zwei Puzzleteile zusammen. Kolibri-Blüten reflektieren Licht meist im Bereich von 600 Nanometern (rot) und bienenbestäubte Blüten eher im Bereich von 400 Nanometern (blau). Mit dem Farbcode sorgen die Pflanzen dafür, dass nur die richtigen Bestäuber zu den Blüten finden.
Verbrannter Plastik für Fledermäuse
Der nächste Strauch hat sich ein anderes Kommunikationsmittel einfallen lassen. Seine Blüten sind grünlich und trichterförmig. Und sie riechen nach verbranntem Kunststoff. Der Nektar schmeckt angenehm süsslich und fruchtig. «Diese Blüte hat sich den Bedürfnissen von Fledermäusen angepasst», erklärt Perret. In der Nacht sehen die Tiere fast nichts, also braucht die Pflanze nicht in eine aufwendige Blütenfarbe zu investieren. Stattdessen kommuniziert sie via Duft. Die Staubblätter sitzen auf kurzen Stielen im Innern des Blütenkelchs, ideal, um die Schnauze seiner nächtlichen Besucher einzupudern.
«Noch vor wenigen Jahren hätte man diese beiden Sträucher nur für entfernte Verwandte gehalten, da ihre Blüten komplett anders aussehen. Aber dank unseren genetischen Analysen wissen wir nun, dass das nicht stimmt. Tatsächlich sind sie sehr nah miteinander verwandt», sagt Perret. Er hat den gesamten Stammbaum der Gesneriengewächse nach der genetischen Verwandtschaft neu geordnet. Dadurch konnte er die Evolutionsgeschichte der Blütenformen rekonstruieren und die Geschwindigkeit messen, mit der die Pflanzen Änderungen am Design vornahmen.
Seine Daten legen nahe, dass sie sich ursprünglich allesamt von Insekten wie Wildbienen und einigen Nachtfaltern bestäuben liessen. Dann veränderte sich plötzlich etwas: Vor etwa zwanzig Millionen Jahren tauchten die ersten Kolibris in Südamerika auf. «Für die Pflanzen eröffnete sich hier eine neue Chance, und viele Arten passten sich den neuen Bestäubern an.» Aus evolutionärer Sicht gab es einen richtiggehenden Run auf die Kolibris, denn in den folgenden Jahrmillionen haben sich Kolibri-Blüten mindestens dreissig Mal unabhängig voneinander entwickelt. Das führte letztlich zu einer Artenvielfalt von über 350 Gesneriengewächsen, die sich ausschliesslich von den winzigen Vögeln bestäuben lassen.
Überrascht hat Perret, dass diese Veränderungen reversibel waren. «Manche Pflanzen stellten von Vogel-Blüten wieder auf Insekten-Blüten um. Vielleicht kam dies in Regionen vor, in denen die Kolibris für einen bestimmten Zeitraum ausgestorben waren.» Vor weniger als zehn Millionen Jahren kam es mit der Ankunft der Fledermäuse zu einer erneuten Anpassungswelle. Acht Mal haben die Pflanzen den Duft als Wegweiser unabhängig voneinander erfunden. «Da diese Entwicklung vor relativ kurzer Zeit erfolgte, ist es bislang bei diesen acht Arten geblieben.»
Heikle Temperaturen und Schädlinge
Sammlungen lebender Pflanzen haben einen hohen wissenschaftlichen Wert. «Nur mit gepressten Pflanzenbelegen hätten wir diese Studie nicht durchführen können, denn beim Trocknen verblassen die Blütenfarben. Alles sieht braun aus.»
Am Botanischen Garten Genf sind zurzeit über 160 Arten vertreten. «Wir erweitern sie jedes Jahr um ein paar Pflanzen. Manche davon sind sogar neu entdeckte Arten, die noch nicht beschrieben wurden», sagt Perret. Dazu arbeitet er mit Forschenden in Südamerika zusammen und ist ab und zu auch selbst im Dschungel unterwegs. Meist in Brasilien, Kolumbien, Ecuador oder Panama.
Der Unterhalt einer Lebendsammlung ist allerdings aufwendig. Im Vorraum zum Mini-Dschungel stapeln sich Hunderte von Blumentöpfen auf Metallgestellen. Pflanzsubstrat wie Torfmoos, Bimskies und Lauberde steht in Säcken und Bottichen bereit. Hier arbeitet Yvonne Menneret. In ihren grünen Gärtnerinnenhosen steckt lässig eine Rebschere. «Es darf keine Staunässe in den Töpfen geben. Aber zu trocken ist auch nicht gut», erklärt sie. Sie unterhält mehrere Treibhäuser nur für die Gesneriengewächse. Bei manchen ist die Temperatur jetzt auf 15 Grad gedrosselt. «Die Pflanzen sind in der Winterruhe», sagt Menneret. Die richtige Temperatur zu halten ist in Zeiten des Klimawandels tückisch. «In einem heissen Sommer wie dem von 2022 gehen viele Pflanzen ein. 30 oder 35 Grad Celsius vertragen sie schlecht.»
Das grösste Problem sind allerdings die vielen Schädlinge wie Blattläuse, Weisse Fliegen und Fadenwürmer. «Unser botanischer Garten ist Bio-zertifiziert. Wir müssen darum bei der Bekämpfung mit Nützlingen wie Marienkäfern, Raubwanzen oder Pilzen arbeiten», erklärt Menneret. Im Wochentakt lässt sie Tausende davon in den Treibhäusern frei.
Im Labor steht Perret vor einer Auslage frisch gepflückter Blüten. Eine nach der anderen zerreibt er mit etwas Methylalkohol in einem Mörser und löst so die Farbpigmente heraus. Mithilfe von Chromatografie teilt er die chemischen Bausteine auf und analysiert sie im Massenspektrometer. Bis heute haben Perret und seine Postdoc Ezgi Ogutcen sieben grundsätzliche Arten von Farbmolekülen in den Blüten entdeckt. Allesamt gehören zu den bei Pflanzen weit verbreiteten Anthocyanen.
«Bei den Gesneriengewächsen entstehen die Pigmente entlang einer genau definierten Produktionskette – wie in einer Fabrik. Die Steuerung des Prozesses erfolgt über wenige Gene», sagt Perret. Hier liegt der Schlüssel zur schnellen Evolution der Blütenfarbe: «Eine geringfügige Veränderung in den Genen führt zur Erzeugung einer anderen Farbe und damit zur Anpassung an verschiedene Arten von Bestäubern.»
In die evolutive Falle getappt
Was ihn überrascht hat: Zwei der sieben Farbmoleküle stammen von den seltenen Deoxy-Anthocyanen. Sie weisen zwei Besonderheiten auf. Erstens: Mit ihnen können Pflanzen nur rote Blüten bilden. Zweitens: Pflanzen, die auf die Produktion dieser beiden Moleküle eingeschwenkt sind, können nicht mehr zu den herkömmlicheren Anthocyanen zurückkehren. «Das heisst, diese Pflanzen stecken in einer evolutionären Falle.» Sie können sich fortan nur noch von den Kolibris bestäuben lassen.
Dreissig Prozent aller von Perret analysierten Gesneriengewächse sind in diese Falle getappt. Warum das passiert, weiss er nicht. «Jedenfalls ist es interessant, wie genetische und chemische Veränderungen das Schicksal einer Pflanzengruppe beeinflussen können. Erst durch unsere Studie verstehen wir die evolutionären Mechanismen, welche die erstaunliche Pflanzenvielfalt in den Tropen und anderswo hervorgebracht haben.»