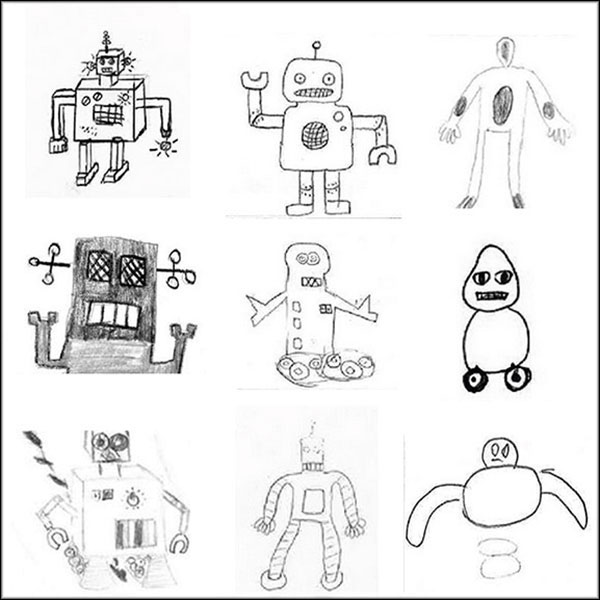ERNÄHRUNGSFORSCHUNG
Die Odyssee einer Studie zu Süssstoffen
Zucker macht krank. Wie hingegen die Ersatzstoffe auf die Gesundheit wirken, sollte eine klinische Studie im Iran endlich klären. Von der Verhedderung einer guten Idee in den Wirren wirtschaftlicher Sanktionen.

Die westliche zuckerhaltige Ernährung erreicht den Iran zunehmend, das westliche Forschungsgeld hingegen darf wegen den internationalen Wirtschaftssanktionen nicht über die Grenze. | Foto: Kaveh Kazemi / Getty Images
Der Dezember 2022 war ein Tiefpunkt für Hamidreza Raeisi-Dehkordi. Es wurde klar: Die klinische Studie für seine Doktorarbeit, die er zwei Jahre lang vorbereitet hatte, würde nicht zustandekommen. Der Forscher aus dem Iran hatte zuvor in der Stadt Yazd, rund 250 Kilometer südöstlich von Isfahan, einen Master in Ernährungswissenschaften absolviert. Er hät- te den Effekt von Süssstoffen bei Frauen in den Wechseljahren mit starkem Übergewicht (Adipositas) studieren wollen. Zusammen mit dem Betreuer seiner Masterarbeit half er, den Förderantrag zu schreiben – beim Programm Spirit des Schweizerischen Nationalfonds, das Forschungszusammenarbeit mit dem globalen Süden fördert und einen besonderen Schwerpunkt auf Frauen legt.
Der Plan von Raeisi-Dehkordi war, im Februar 2021 nach Bern zu kommen, wo er die wissenschaftliche Analyse durchgeführt hätte. Doch wegen der Covid-Pandemie erhielt er kein Visum. «Es war eine schwierige Situation, ich arbeitete umsonst, lebte bei meinen Eltern und musste zum obligatorischen Militärdienst, weil ich nach meinem Studium nicht sofort einen anderen Job erhalten hatte.» Im Dezember desselben Jahres klappte es dann endlich. Während insgesamt zweier Jahre im Iran und in der Schweiz bereitete er alles vor: das Studienprotokoll, die Bewilligungen der Ethikkommission und der Universität Yazd. Aber es hat nicht sollen sein, wie er heute weiss.
Dabei wäre die Studie sehr relevant gewesen, aus vielfältigen Gründen: Der Überkonsum von Zucker weltweit führt zu Karies, Übergewicht und einer Reihe von chronischen Krankheiten wie Diabetes Typ 2. Die Nahrungsmittelindustrie und Konsumenten setzen deswegen auf Süssstoffe wie Aspartam, Saccharin und Stevia. Doch deren Effekt auf die Gesundheit ist umstritten. So wurde Aspartam 2024 von der WHO sogar als «möglicherweise krebserregend» eingestuft, was für Aufregung sorgte. Es fehlt an solidem Wissen. Die Abläufe im Stoffwechsel sind vor allem aus Tierstudien bekannt, deren Übertragbarkeit auf den Menschen begrenzt ist. Und bei den vorhandenen Beobachtungsstudien von Menschen bleibt stets unklar, welches die Ursache und welches die Wirkung ist.
Iranische Stadt Yazd ist ideales Terrain
«Wir wissen, dass Adipositas mit Diabetes Typ 2 assoziiert ist», sagt Angéline Chatelan, Professorin für Ernährungsepidemiologie an der Hochschule für Gesundheit in Genf. Unklar sei hingegen die genaue Rolle des Zuckers und ob Süssstoffe wirklich besser sind. Deshalb hatte sie mit dem Doktoranden Raeisi-Dehkordi und einem Forschungsteam die nun nicht zustande gekommene klinische Studie entworfen. Deren Ziel war es, die Effekte von Aspartam, Saccharin, Stevia sowie normalem Haushaltszucker auf Darmbakterien zu testen, ebenso auf Gewicht, Zuckerhaushalt, Marker für Herzkreislaufgesundheit und Sexualhormone. Insgesamt 160 Iranerinnen, die sich in den Wechseljahren befinden und Adipositas haben, hätten täglich eine Flasche mit dem ihnen zugeteilten Süssungsmittel in Wasserlösung erhalten.
Frauen sind in klinischen Studien generell untervertreten, weil es häufig einfacher ist, sie mit Männern durchzuführen. Das hat auch mit den Hormonen zu tun, wie Chatelan am Beispiel ihrer eigenen – gescheiterten – Studie erklärt: «Wir müssen den Effekt des Menstruationszyklus vom Effekt des Süssstoffs unterscheiden. Viele Frauen nehmen zudem die Verhütungspille.» Die Abgabe von Blut, Urin und Kotproben jeweils mit dem Zyklus jeder Teilnehmerin zu koordinieren, wie es bei der Studie ursprünglich vorgesehen gewesen wäre, hätte das Spitalpersonal vor zu grosse Herausforderungen gestellt. Da boten sich Frauen in den Wechseljahren an, bei denen die Monatsblutungen bereits ausgesetzt haben. Sie gehören zwar nicht zu den bedeutendsten Konsumentinnen von Süssstoffen – das sind die jungen Frauen –, haben aber ein erhöhtes Risiko, Übergewicht zu entwickeln.
Die Studie sollte im Iran durchgeführt werden, weil «die Länder des Nahen Ostens zu den am stärksten von Übergewicht betroffenen gehören», so Chatelan. In Yazd leide rund die Hälfte der Frauen nach den Wechseljahren unter Adipositas. Hinzu kommt, dass Süssstoffe im Iran noch nicht so verbreitet sind wie etwa in der Schweiz. Also auch ein perfektes Terrain, um kleine Effekte auf die Darmbakterien zu untersuchen. Im Iran seien die Ernährungswissenschaften zudem stark entwickelt. «Das ist richtig», untermauert Amin Salehi-Abargouei, der iranische Partner des Projekts. Er ist Professor an der Shahid Sadoughi University für medizinische Wissenschaften in Yazd. «Im Iran gibt es seit 1961 den Studiengang in Ernährungswissenschaften.» Salehi-Abargouei spricht von 46 Departementen, 23 Forschungszentren zum Thema und 2100 Publikationen pro Jahr.
Die Bedingungen wären also optimal gewesen. Doch die internationalen wirtschaftlichen Sanktionen brachten das Projekt zu Fall. Es gab schlicht keinen legalen Weg, die 20 000 Franken für die Saläre des Personals der klinischen Studie von der Schweiz in den Iran zu überweisen. Eine grosse Enttäuschung für Salehi-Abargouei: «Ein internationales Embargo sollte nicht die Forschung und noch weniger die wissenschaftliche Zusammenarbeit für die Gesundheit der Menschen tangieren.»
Für den Doktoranden Raeisi-Dehkordi ging es dabei auch um seinen Job. Er war nun, nach zwei Jahren Vorbereitung, ohne Forschungsprojekt in Bern gestrandet. Sein Betreuungsteam, Chatelan, Salehi-Abargouei und Oscar H. Franco, Professor für Public Health am Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern, bot ihm deswegen ein anderes an: Es geht um Geschlechtshormone und Herzkreislaufgesundheit bei Frauen.
Wie wichtig die Studie gewesen wäre
Das Süssstoffprojekt wurde für Raeisi-Dehkordi daher zur Nebengeschichte. Das Team gab es nicht auf und entschied, auf zwei daraus abgeleitete Projekte zu fokussieren: Als erstes wurde in einer systematischen Übersichtsstudie über bereits bestehende Übersichtsstudien zusammengetragen, was über den Zusammenhang von Süssstoffen und Krankheiten bekannt ist. Resultat: Die starken Süssstoffe scheinen tatsächlich mit einem höheren Risiko für Diabetes, Herzkreislauferkrankungen und verschiedene Krebsarten verbunden zu sein. «Es ist allerdings zu bedenken, dass die Zusammenhänge nicht stark sind», schreibt das Team. Chatelan betont: «Wir wissen nicht, was zuerst kommt: Die Menschen, die am meisten Süssstoffe konsumieren, sind ja wahrscheinlich eher die Übergewichtigen.»
Genau um solche falschen Zusammenhänge zu eliminieren, hätte es die klinische Studie gebraucht. Die Daten von bestehenden Kohorten zu analysieren, war nun die nächstbeste Lösung. Für das zweite Folgeprojekt wurden deswegen die Informationen zu knapp 25 000 Amsterdamern und Amsterdamerinnen verwendet, deren Lebensweise und Gesundheit seit 2011 systematisch verfolgt werden. Raeisi- Dehkordi zog unter anderem auch deswegen mit seinem Betreuer Franco von Bern nach Utrecht in die Niederlande.
Die Amsterdamer Kohorte war die einzige, an deren Daten die Gruppe innert vernünftiger Zeit gelangen konnte. «Open Science ist nicht immer so offen», erklärt Chatelan. Die Leiterinnen weiterer ähnlicher Studien wollten meistens zuerst ihre eigenen Resultate publizieren. Der Schutz der Privatsphäre der Patientinnen macht die Prozeduren zudem langwierig. Dazu komme ein Fachkräftemangel für die Analyse von Darmbakterien in Europa.
Noch sind die Süssstoffanalysen zur Amsterdamer Kohorte nicht publiziert. Chatelan meint aber: «Mein Bauchgefühl sagt, dass wir es nicht bestimmen können, ob das Darmmikrobiom von Süssstoffen beeinflusst wird.» Doch selbst wenn das klar wäre, müsste in Zukunft immer noch gezeigt werden, dass wirklich die Darmbakterien für das erhöhte Gesundheitsrisiko verantwortlich sind. Erst dann wäre die Kette von Ursache und Wirkung vollständig belegt.
Für eine definitive Aussage bräuchte es eine klinische Studie wie die ursprünglich geplante. «Eigentlich müsste man die Auswirkungen jedes einzelnen Süssstoffs untersuchen, und zwar sowohl kurzfristig direkt nach der Einnahme als auch nach langfristigem Konsum», sagt Anne Christin Meyer-Gerspach, Co-Leiterin der Übergewichts-, Diabetes- und Stoffwechselforschung am Claraspital in Basel. Sie findet deshalb: «Das Projekt im Iran wäre grossartig gewesen. Es hätte endlich eine Interventionsstudie bei genau der Gruppe gegeben, die uns interessiert.» Sie betont aber noch: Zucker bleibe so oder so deutlich schlimmer als die gängigen Süssstoffe. Die WHO lege bei Letzteren den Sicherheitsmassstab sehr hoch an. Deshalb ist sie überzeugt: «Als Erstes sollte der süsse Geschmack in den Produkten generell reduziert werden. Dann könnten wir im niedrigeren Bereich den restlichen Zucker mit Süssstoffen ersetzen.»
Mit der übriggebliebenen Amsterdamer Kohorte beschäftigt ist nur Raeisi-Dehkordi, der wegen der durch die Einreiseprobleme ausgelösten Verzögerung noch Zeit hat, den letzten Teil zur Publikation zu bringen. Das zumindest wird ein Teil seiner Dissertation werden.