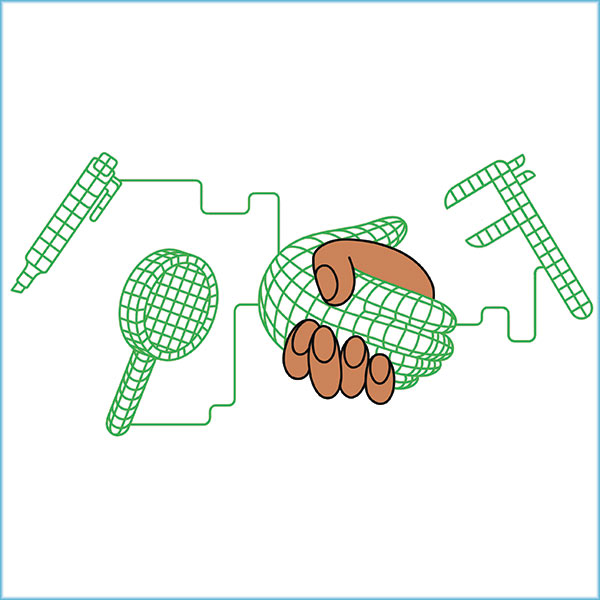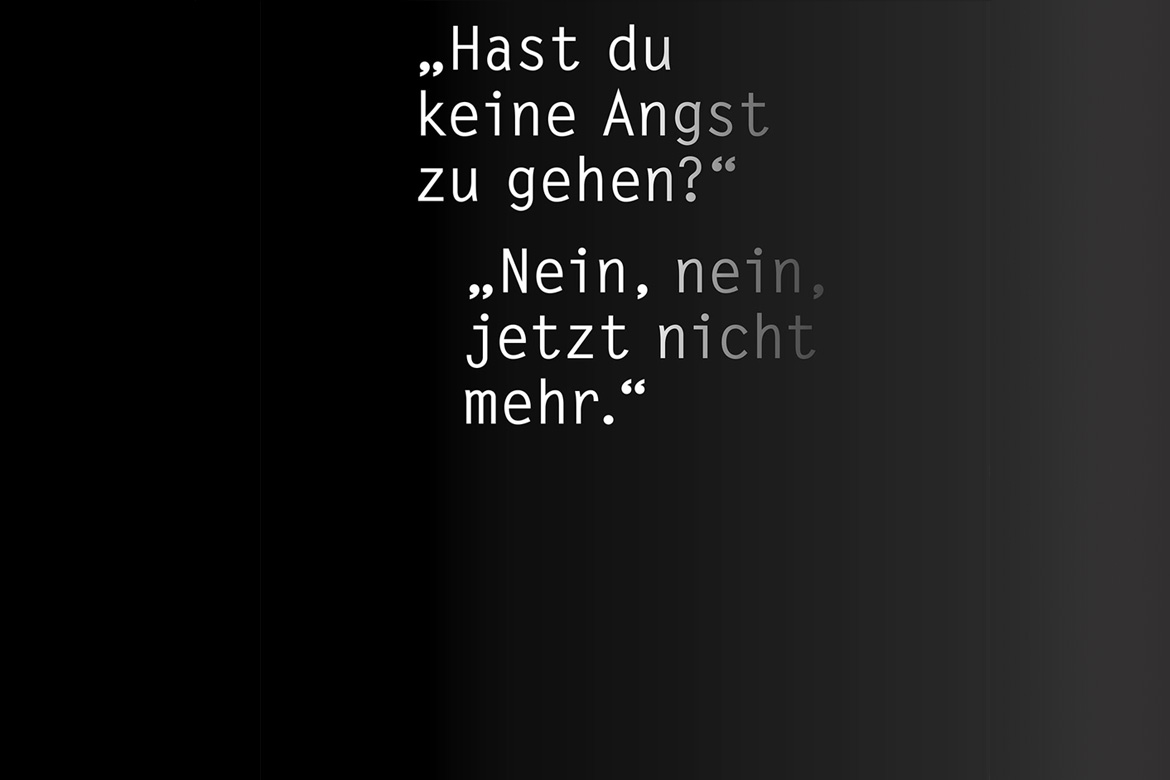NACHHALTIGKEIT
Die Kehrseite der olympischen Medaille
Salt Lake City schlägt sich nicht schlecht, Sotschi dagegen sehr. Eine Längsschnittstudie aus Lausanne zeigt, dass die Mega-Events den Ansprüchen an die Nachhaltigkeit nicht gerecht werden.

Traurige Aussicht: Im Sommer 2004 konnten die Zuschauerinnen von hier die Kanu-Disziplinen der Olympischen Sommerspiele von Athen beobachten. | Foto: Jamie McGregor Smith
Die Olympischen Spiele und die Fifa-Weltmeisterschaften sind die am meisten beachteten und teuersten Sportanlässe der Welt. Die Mega-Events können ganze Städte so schnell transformieren wie kein anderer politischer Entscheid. Sie könnten also Gelegenheit bieten, um in diesen Städten die Nachhaltigkeit voranzutreiben. Doch bisher wurde diese Chance selten genutzt. Dies zeigen die ersten Ergebnisse einer Längsschnittstudie von Martin Müller, Professor für Humangeografie an der Universität Lausanne, der die Auswirkungen der Grossereignisse untersucht.
Die Befunde erlauben es, die Entwicklung der Nachhaltigkeit von Olympia seit 1992 nachzuzeichnen. Müllers Forschungsteam analysierte bei den 15 Anlässen jeweils drei Dimensionen von Nachhaltigkeit: Für die Auswirkungen auf die Ökologie schaute es etwa den Anteil neuer Bauten oder den ökologischen Fussabdruck der Besucherinnen an, für die Auswirkungen auf die Gesellschaft betrachtete es unter anderem die vorgenommenen Gesetzesänderungen und den sozialen Frieden. In der Wirtschaft waren Budgetüberschreitungen und die Nutzung der Anlagen nach dem Event entscheidend. Überraschenderweise wurden die Sportanlässe immer weniger nachhaltig – obwohl zum Beispiel die Organisatorinnen in Vancouver (Winter 2010) von den «ersten nachhaltigen Spielen der Geschichte » sprachen.
Entgegen allen Erwartungen waren die nachhaltigsten Spiele seit 1992 jene von Salt Lake City (Winter 2002), bei denen die ökologische Frage nicht Teil der Kommunikation war. An zweiter Stelle folgen die Spiele von Albertville (Winter 1992), deutlich vor jenen in Barcelona (Sommer 1992). Das Schlusslicht bilden die Spiele von Sotschi (Winter 2014), knapp hinter jenen von Rio (Sommer 2016). «Diese Resultate erstaunen mich nicht», sagt Geograf Christopher T. Gaffney, Professor an der Universität New York, der bis 2017 an der Studie mitwirkte. «Die Olympischen Spiele sind nach einer kapitalistischen Logik gewachsen. Heute werden sie dem Kriterium der Nachhaltigkeit immer weniger gerecht.» Doch auch die Spiele von Salt Lake City, die am besten abgeschnitten haben, können laut Martin Müller nicht als nachhaltig bezeichnet werden. «Die Organisatoren schlugen sich vor allem in finanziellen Belangen gut. Bei Kriterien wie der Besucherzahl oder der Mobilität der Bevölkerung hingegen haben sie nur wenig bessere Noten erhalten als andere», erklärt er.
Blütezeit vorbei
Wie liesse sich dieser Trend umkehren, wie könnten umweltverträglichere Spiele realisiert werden? «Unsere Empfehlungen gehen in Richtung kleinerer Events», erklärt Martin Müller. «Gut wäre auch ein Netz aus beteiligten Städten und eine unabhängige Überprüfung der Nachhaltigkeitsstandards.» Der letzte Punkt ist wichtig, weil die Organisatorinnen gemäss der Studie ökologische Massnahmen bevorzugen, die spektakulär klingen, aber kaum Einfluss auf die sozioökonomischen Strukturen haben. «In Tokio wurde verkündet, dass die Medaillen aus gebrauchten Telefonkomponenten bestehen. Dies ist jedoch ein vernachlässigbarer Aspekt», erläutert Müller.
Christopher T. Gaffney ist nicht sehr zuversichtlich: «Die internationalen Sportorganisationen werden sich ohne massiven Druck von aussen nicht freiwillig ändern. Ihr Funktionsmodell ist weder nachhaltig noch inklusiv und einer fairen Ressourcenverteilung abträglich. » Könnte die Pandemie Fortschritte bringen? «Prognosen sind schwierig», meint Christopher T. Gaffney. «Doch falls sich das gesellschaftliche Verhalten durch das Coronavirus langfristig ändert, ist es vielleicht nicht mehr denkbar, dass so viele Leute an einem Ort zusammenkommen. Ich erwarte jedoch, dass der Wandel eher von der jungen Generation ausgeht. Sie hat einen anderen Medienkonsum und begeistert sich weniger für solche Anlässe.» Eine Tendenz sehen beide Forscher: Die Blütezeit der Mega-Events gehört definitiv der Vergangenheit an.