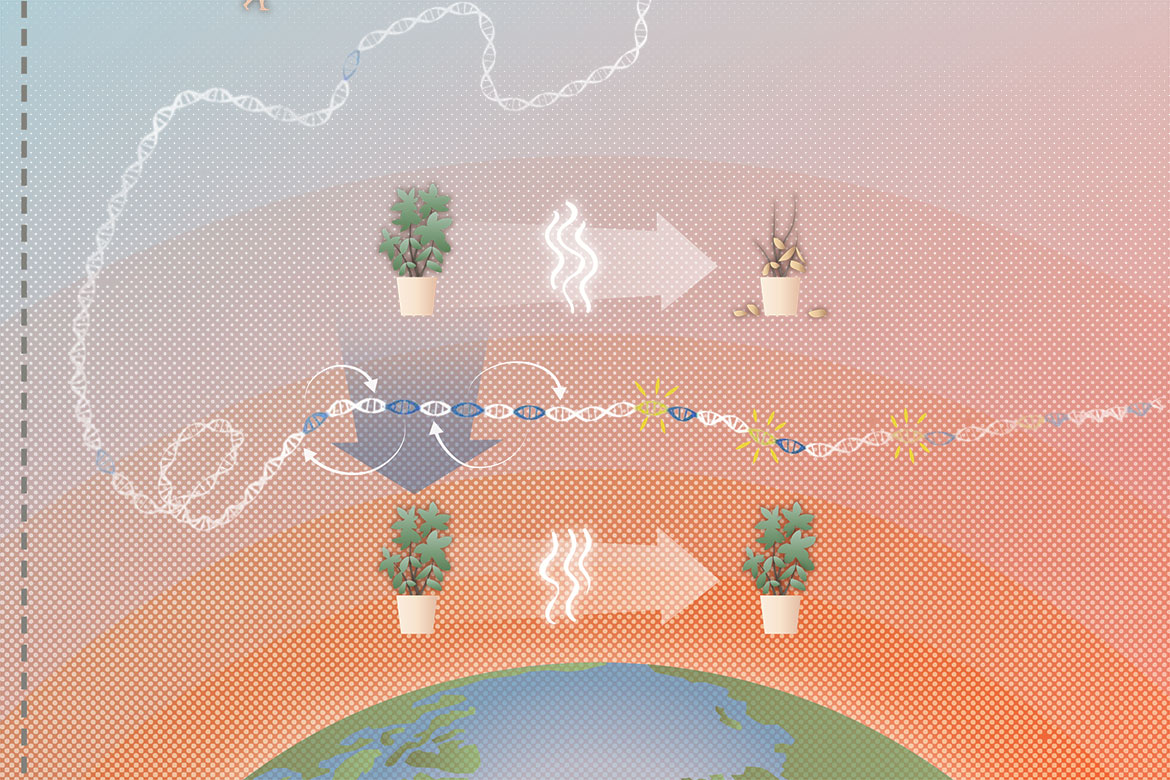Reportage
Evolution wilder Hausmäuse in der Scheune
In einem weltweit einzigartigen Projekt beobachten Forschende der Universität Zürich seit 17 Jahren eine Population wildlebender Hausmäuse. Dadurch gewinnen sie Erkenntnisse, die in Laborversuchen unsichtbar bleiben. Ein Besuch in der Scheune.

Forschungstechniker Bruce Boatman und Evolutionsbiologin Anna Lindholm analysieren in einer Illnauer Scheune das Sozialverhalten von Hausmäusen. | Bild: Joel Hunn
Kaum zu glauben, dass in diesem Raum von 80 Quadratmetern 600 Hausmäuse leben. Jetzt, um 10 Uhr an einem sonnigen Frühlingsmorgen, sind nur wenige der dämmerungs- und nachtaktiven Bewohner unterwegs. Sie knabbern an Kernen, und immer wieder huscht ein graubraunes Knäuel durch eines der Löcher in den schmalen Trennwänden. Die flinken Tierchen sind Teil eines weltweit einzigartigen Forschungsprojekts: Schon seit 17 Jahren beobachten Forschende der Uni Zürich in dieser Scheune bei Illnau eine Population wildlebender Hausmäuse. «Damit können wir Erkenntnisse über das Sozialleben der Tiere gewinnen, die in Laborversuchen nur lückenhaft oder gar nicht sichtbar sind», erklärt Anna Lindholm, Evolutionsbiologin an der Uni Zürich. Etwa wie sich soziale Bindungen zwischen den Tieren etablieren und welchen Einfluss diese Bindungen auf das Verhalten, die Fortpflanzung und die Konkurrenz innerhalb der Mäusegesellschaft haben.
Die Konkurrenz hinterlässt blutige Spuren. Forschungstechniker Bruce Boatman stapft durch die Scheune und sucht den Strohboden ab. Heute findet er zwei getötete Mäusebabys, beide sind angefressen. «Die Männchen töten Neugeborene von Weibchen, mit denen sie nicht kopuliert haben und entfernen so die Konkurrenz aus dem Genpool», erklärt Boatman. Doch auch die Weibchen töten Babys von anderen Müttern. Dies obschon sie bei der Aufzucht der Jungen häufig in einem Nest zusammenarbeiten. In solchen Gemeinschaftsnestern beschützen, wärmen und säugen die Weibchen alle Jungen zusammen. «Dieses kooperative Verhalten wollte ich verstehen», sagt Evolutionsbiologin Barbara König, Initiantin und Leiterin des Projekts.
Darum hat sie die Population aufgebaut, ursprünglich mit 12 Mäusen von benachbarten Bauernhöfen. In der Scheune sorgen die Forschenden für einen geeigneten Lebensraum mit Stroh, Futter und 40 gemütlichen Nestboxen. Dreimal pro Woche ist ein Teammitglied vor Ort, um die Entwicklungen in der Population zu dokumentieren. Die Forschenden registrieren neue Würfe, nehmen von allen Individuen Proben für genetische Analysen und chippen sie, wenn sie geschlechtsreif werden. Sind die Mäuse gechippt, werden sie Teil des Herzstückes des Scheuneprojektes: In den Zugangstunneln zu den Nestern registrieren Funkantennen die IDs der einzelnen Tiere automatisch. Dadurch wird sichtbar, welche Mäuse in welchen Nestern zuhause sind und wie viel Zeit sie mit welchen Artgenossen verbringen.
Die Forschenden fanden heraus, dass die Weibchen ihre Aufzuchtstrategie je nach Situation anpassen. Jüngere und entsprechend körperlich noch schwächere Weibchen tendieren dazu, mit anderen Müttern zusammenzuarbeiten. Zwar müssen sie dann damit rechnen, dass die Nistpartnerinnen einen Teil des Nachwuchses töten. «Dennoch haben sie so eine grössere Chance ein Junges durchzubringen als allein», sagt König. Dagegen ziehen ältere und stärkere Weibchen ihren Nachwuchs häufig auch allein erfolgreich auf.
Zudem haben die Daten aus der Illnauer Scheune aufgedeckt, dass die Konkurrenz unter Weibchen ähnlich gross ist wie die unter Männchen. Das wird am Ungleichgewicht beim Fortpflanzungserfolg einzelner Tiere sichtbar: Wie bei den Männchen hinterlässt nur gerade die Hälfte der Weibchen lebende Nachkommen. «Die Konkurrenz unter Weibchen wurde zuvor unterschätzt», sagt König. Denn bei im Labor gehaltenen Hausmäusen pflanzen sich so gut wie alle Weibchen fort, und sie entscheiden sich immer für die Kooperationsstrategie. Die vergleichsweise stabile Umgebung einer Laborhaltung führt also zu einem anderen Verhalten als in natürlichen Populationen.
Ein Supergen migriert
In der Scheune hebt Bruce Boatman den Deckel von einer der Nestboxen und findet darin zwei Mäusebabys – blind, nackt und kaum grösser als ein Fünfliber. «13 Tage alt», schätzt Boatman. Er hebt die Tierchen vorsichtig am Nacken heraus. Sie kommen auf die Waage, und Körper- und Kopflänge werden gemessen. Mit einer speziellen Zange klippt Boatman danach jedem ein winziges Stückchen vom Ohr ab. «Dort hat es nur wenige Nervenenden, darum verursacht das kaum Schmerzen», erklärt Anna Lindholm. Sie wird aus den Proben im Labor die DNA isolieren, um die Verwandtschaft zwischen den Mäusen und weitere genetische Merkmale zu analysieren und mit den Beobachtungen aus der Scheune zu verknüpfen.
Dadurch ist die Forscherin unter anderem auf die Auswirkungen eines bestimmten Supergens gestossen: der sogenannte t-Haplotyp. Das ist ein Komplex aus mehreren gemeinsam vererbten Genen, der sich gegenüber anderen Genen einen Vorteil verschafft: Spermien, die dieses Supergen tragen, hemmen die Beweglichkeit anderer Spermien desselben Tieres und erhöhen so ihre Chance, vererbt zu werden. Durch die Kombination der genetischen Daten mit jenen der Funksender in der Scheune haben Lindholm und ihr Doktorand Jan-Niklas Runge erkannt, dass das Supergen das Migrationsverhalten der Mäuse beeinflusst. Bei Trägern des Haplotyps ist nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie dauerhaft aus der Scheune auswandern, um fast 50 Prozent höher, als bei Tieren, die das Supergen nicht haben. «So sorgt der Haplotyp für seine Weiterverbreitung», sagt Lindholm.
Draussen vor der Scheune schleicht inzwischen eine Katze umher. Lindholm und Boatman kennen den schwarzweissen Schelm. Er gehört zu jenen Stubentigern, die immer wieder mal um die Scheune streifen. Hinein können die Räuber aber nicht. «Nur einmal, im Januar 2019, hatten wir eine Tragödie», erzählt Anna Lindholm. Vermutlich konnten sich ein paar kleingewachsene Katzen durch den mit Maschendraht gesicherten Spalt unter der Tür zwängen. In einer einzigen Nacht fiel über ein Drittel der Mäuse entweder den Katzen zum Opfer oder verliess die Scheune fluchtartig für immer. Inzwischen hat sich die Population wieder erholt.
Kranke Mäuse isolieren sich selbst
Das ist gut so, denn das Langzeitprojekt hat ganz unterschiedliche wissenschaftliche Erkenntnisse hervorgebracht, einige davon völlig unerwartet. So entdeckten die Forschenden etwa, dass ihre Mäuse Anzeichen von Domestizierung entwickelten. Damit ist nicht das Verhalten gemeint – die Mäuse flüchten vor Menschen und wehren sich, wenn sie in die Hand genommen werden. Gemeint sind körperliche Veränderungen: So bekamen immer mehr der Mäuse weisse Flecken im Fell und Schädel und Schnauzen wurden kürzer. Solche Veränderungen entstehen bei vielen domestizierten Tierarten – wie etwa Hunden – Hand in Hand mit einem zahmeren Verhalten. Offenbar reicht dafür aber schon der regelmässige Kontakt zum Menschen aus.
Eine weitere Erkenntnis betrifft das Verhalten der Tiere, wenn sie krank sind. Quer durchs Tierreich lässt sich beobachten, dass kranke Tiere weniger aktiv sind und ihre Sozialkontakte reduzieren. In der Scheunenpopulation hat das Team das soziale Netzwerk kranker Tiere näher untersucht. Dazu spritzten die Forschenden ausgesuchten Mäusen einen biochemischen Stoff, der dem Immunsystem eine Infektion vortäuscht. Sie erkannten anhand der Antennendaten, dass sich 40 Prozent der scheinkranken Mäuse sozial isolierten. Als Folge würde eine Krankheit nicht die gesamte Population befallen und schneller wieder verschwinden als bei unverändertem Sozialverhalten, wie nachfolgende Modellrechnungen zeigten.
Noch dieses Jahr wird Barbara König pensioniert, darum wird auch ihr Langzeit-Mäuseprojekt aufgelöst. Dennoch kann der gesammelte Datensatz weiterhin verwendet werden. Schon gestartet ist etwa eine Kooperation mit Forschenden der Uni Bern, die in Stuhlproben der Scheunenmäuse die Darmflora untersuchen. Die Befunde will das Team mit der genetischen Verwandtschaft und dem sozialen Verhalten der Mäuse vergleichen. Forschende aus Dresden wiederum haben in Fellproben Geschlechts- und Stresshormone gemessen. Die Ergebnisse verknüpfen sie mit dem Verhalten der Tiere. So lässt sich beispielsweise untersuchen, wie sich längerfristiger Stress auswirkt.
Inzwischen hat Techniker Boatman noch eine defekte Tunnelantenne repariert. Danach ist für heute Feierabend, und die Mäuse dürfen wieder ungestört fressen, kopulieren, sich um ihre Jungen kümmern und ihre sozialen Bindungen pflegen. Boatman und Lindholm schliessen ab und stellen zuletzt einige Materialkisten vor die Tür – als Sicherheitsmassnahme gegen die Katzenplage.