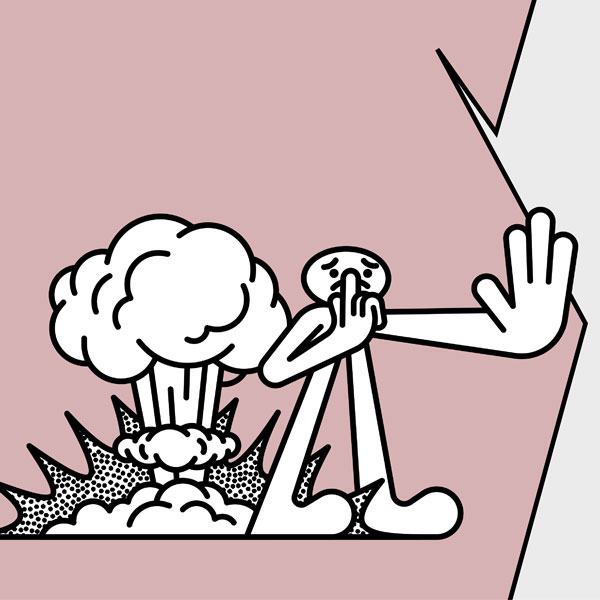Philipp Theisohn: «Der wahnsinnige Professor übertritt gesellschaftliche Grenzen»
Wissenschaft liefert guten Stoff für Geschichten. Und Forschende sind dankbare Figuren, sagt Literaturprofessor Philipp Theisohn.

Laut Literaturwissenschaftler Philipp Theisohn kommt an Umberto Eco niemand heran. | Bild: Valérie Chételat
Verrückte Genies, Bösewichte oder die Leiche: Einfach haben es Forschende als Protagonisten in der Literatur nicht.
Einfach haben es Forschende nie, aber das Klischee ist nicht richtig. Heute verstehen besonders jüngere Autorinnen den wissenschaftlichen als einen poetischen Blick. Sie nutzen ihn, um Geschichten zu erzählen. Das verdankt sich der romantischen Tradition, die Naturwissenschaft und Dichtung zusammendenkt. Was Sie ansprechen, sind Ikonen wie Dr. Strangelove. Die entsprechen dem Faustischen Ideal: Die Erkenntnis steht über allem. Der wahnsinnige Professor übertritt gesellschaftliche Grenzen und ist vom szientifischen Teufel besessen.
Warum eignen sich Wissenschaftler als literarische Figuren?
Weil sie ambivalent sind. Sie denken stark in Strukturen und sind zugleich Alltagsmenschen. Das erzeugt Spannung. Wie lebt eine Person, deren Passion die Mikrobiologie ist? Geht die ans Buurezmorge? Wie führt der Psychologe eine Liebesbeziehung?
Forschende greifen auch selber in die Tasten. Woher kommt der Wunsch nach Fiktion bei einer Berufsgattung, die nach Fakten sucht?
Jeder, der sich dem Unbekannten gegenübersieht, muss mit Annahmen arbeiten. Die Science-Fiction etwa imaginiert eine begehbare Welt, zum Beispiel nach dem Klimawandel. Indem in diesen literarischen Räumen dann neue Fragestellungen auftauchen, stiftet die Fiktion durchaus Erkenntnisse.
Dann ist die Fiktion ein Sehnsuchtsort für Wissenschaftler?
In bestimmter Weise. In der Fiktion können Fragen spontan und provisorisch gelöst werden. Selbst ein Wurmforscher muss in seiner Arbeit fiktionalisieren und seine Resultate interpretieren. Wer eine Gletschermumie seziert, begibt sich dabei immer auch auf die Suche nach deren Herkunft. Das ist Fiktion.
Wollen schreibende Wissenschaftler ihre Fakten unter die Leute bringen?
Das sind meistens die schlechtesten Bücher. Wer einen Roman aus dem Anliegen schreibt, Zellbiologie zu erklären, hat das Genre verfehlt.
Welcher Wissenschaftler hat die besten Bücher geschrieben?
An Umberto Eco kommt niemand ran.
Haben Romane über die Wissenschaft einen Wert in der Vermittlung von Wissen über die akademische Welt?
Man erfährt, wie Wissenschaftlerinnen die Welt sehen. Wie sich das systematische Denken, das auf Objektivierung ausgelegt ist, auf die subjektive Welterfahrung auswirkt. Liest ein Nicht-Wissenschaftler einen Roman, bei dem ein Wissenschaftler im Zentrum steht, stellt er oder sie sich auf eine Welt ein, die durch einen bestimmten Filter gegangen ist. Die Wissenschaftlerin zerlegt auf ihre Weise die Welt und setzt sie neu zusammen. Wie erlebt der Soziologe einen Discobesuch? Das Performative ist in solchen Texten entscheidender als fachliche Details. Wie Klonen funktioniert – so es funktioniert –, kann man auch auf Wikipedia lesen.
Inwiefern wirkt die literarische Fiktion auf die Wissenschaft?
Man darf nicht zu stark vereinfachen. Nur weil Edward Bellamy 1888 eine Geldkarte imaginiert hat, ist deren heutige Existenz nicht zwingend geworden. Die Fiktion ist das eine. Entscheidend sind die Bedürfnisse, die wir erahnen. Wenn ich eine fremde Welt imaginiere, schaffe ich auch den Raum für Dinge, deren Notwendigkeit wir noch nicht sehen, also auch für Erfindungen. Das ist der Grund, warum man im Silicon Valley gern Schriftsteller anheuert. Die sind der Wirklichkeit nämlich bisweilen voraus.