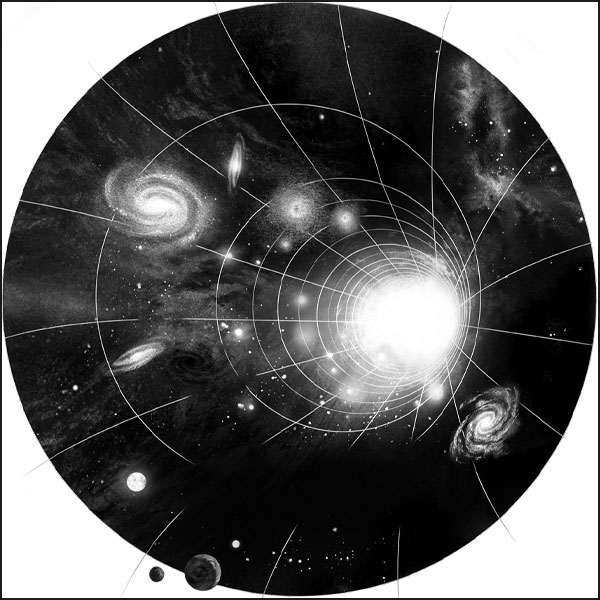DEBATTE
Ist der geplante neue Teilchenbeschleuniger am Cern gut für die Schweiz?

Foto: ZVG

Foto: ZVG
Das Cern ist zwar ein Flaggschiff der wissenschaftlichen Forschung. Und Genf kann stolz darauf sein, diese Institution zu beherbergen, die Wissen in die ganze Welt ausstrahlt. Obwohl ich Wissenschaft schätze, habe ich aber Zweifel am zukünftigen Teilchenbeschleuniger (FCC). Jeder wissenschaftliche Fortschritt muss letztlich auch verantwortungsvoll sein. Der FCC steht für jahrzehntelange Bauarbeiten, Hunderttausende von Kubikmetern Aushub, jahrelange Lastwagenfahrten, Staub und Lärm. Schätzungen gehen von mehreren Dutzend Milliarden Franken Kosten aus, ohne die Instandhaltung oder die Energie für den Betrieb zu berücksichtigen. Das Projekt würde die Hälfte des jährlichen Stromverbrauchs des Kantons Genf verschlingen. Wer kann, während Klimaschutz ein dringliches Anliegen ist, ein solches Projekt vorbehaltlos unterstützen?
Auch der demokratische Aspekt darf nicht ausgeblendet werden. Der Bundesrat hat ein Vernehmlassungsverfahren zu einem Sachplan für die Cern-Projekte eingeleitet. Der Text unterliegt aber nicht dem Referendum. Bei einem Projekt dieser Grösse ist eine Entscheidung ohne öffentliche Debatte mehr als problematisch. Ich glaube an eine partizipative Wissenschaft, nicht an eine Planung im stillen Kämmerlein. Schliesslich geht es auch um Prioritäten. Die Wissenschaft braucht alle verfügbaren Mittel, um die dringlichen aktuellen Herausforderungen zu bewältigen: Klima, Gesellschaft und Wirtschaft. Die Erweiterung des Cern scheint dieses Ziel zu verfehlen. Und dies in einer Zeit, in der die Legitimität der Wissenschaft auf besorgniserregende Weise infrage gestellt wird. Denn sie wird nicht nur an grossen Leistungen gemessen, sondern auch daran, ob sie verstanden, geteilt und kollektiv getragen wird.
Meine Position ist keineswegs nur ideologisch, sondern sehr pragmatisch. Sie gründet auf der Vision einer Wissenschaft, die nicht vom Alltag der Menschen abgekoppelt ist, sondern die Bürgerinnen und Bürger, die Demokratie, die Biodiversität der Regionen und das Klima genauso respektiert wie die menschliche Neugier.
Delphine Klopfenstein Broggini ist grüne Nationalrätin aus Genf und engagiert sich seit einigen Jahren in Debatten um den Future Circular Collider.
Als Teilchenphysikerin begeistert mich das Konzept des Future Circular Collider (FCC), denn er eröffnet neue Möglichkeiten, elementare Fragen über unser Universum zu erkunden. Die Grundlagenforschung basiert auf Neugier. Sie verfolgt keine unmittelbaren praktischen Anwendungen, sondern dient dazu, tiefergehende Erkenntnisse zu gewinnen. Oft führen gerade Entdeckungen, die zu Beginn keinen offensichtlichen Nutzen haben, später zu bedeutenden Fortschritten. Die Teilchenphysik, insbesondere die Forschung am Cern, liefert dafür zahlreiche Beispiele. Seien es Teilchenstrahlen zur Krebsbehandlung, Detektoren zur Bildgebung oder die Entwicklung des Internets.
Am Cern arbeiten Menschen aus der ganzen Welt. Sie entwickeln gemeinsam neue Experimente und Technologien. Es ist also auch ein Modell für erfolgreiche und friedliche internationale Zusammenarbeit. Und es trägt zum Ruf der Schweiz als Ort der Spitzenforschung entscheidend bei. Zudem ist es ein attraktiver Wirtschaftspartner: In Form von Aufträgen an die Industrie und an Dienstleister fliesst bis zum Dreifachen des jährlichen Beitrags der Schweiz an das Cern in das Land zurück. Daher ist der Bau des neuen Teilchenbeschleunigers auch ökonomisch interessant. Gleichzeitig bildet das Cern zusammen mit Universitäten und Forschungsinstituten die nächste Generation in verschiedensten Fachbereichen wie Physik, Ingenieurwesen oder Datenwissenschaften aus. Die Schweizer Wissenschaft profitiert stark davon.
Der FCC ist ein äusserst ambitioniertes Projekt – und das muss er auch sein, wenn er bahnbrechende Entdeckungen ermöglichen soll. Er bietet ein umfassendes und weltweit einzigartiges Physikprogramm. Derzeit ist Europa führend in der Teilchenforschung. Mit dem FCC würde das auch in den kommenden Jahrzehnten so bleiben. Dies stärkt die Idee von Fortschritt durch Zusammenarbeit, die in diesen Zeiten wichtig ist. Und so ziehen Europa und die Schweiz internationale Talente an, deren innovative Forschung uns allen zugutekommt.
Lea Caminada ist Gruppenleiterin Hochenergiephysik am Paul-Scherrer-Institut PSI und Professorin an der Universität Zürich. Sie forscht selbst am Cern.

Foto: ZVG
Das Cern ist zwar ein Flaggschiff der wissenschaftlichen Forschung. Und Genf kann stolz darauf sein, diese Institution zu beherbergen, die Wissen in die ganze Welt ausstrahlt. Obwohl ich Wissenschaft schätze, habe ich aber Zweifel am zukünftigen Teilchenbeschleuniger (FCC). Jeder wissenschaftliche Fortschritt muss letztlich auch verantwortungsvoll sein. Der FCC steht für jahrzehntelange Bauarbeiten, Hunderttausende von Kubikmetern Aushub, jahrelange Lastwagenfahrten, Staub und Lärm. Schätzungen gehen von mehreren Dutzend Milliarden Franken Kosten aus, ohne die Instandhaltung oder die Energie für den Betrieb zu berücksichtigen. Das Projekt würde die Hälfte des jährlichen Stromverbrauchs des Kantons Genf verschlingen. Wer kann, während Klimaschutz ein dringliches Anliegen ist, ein solches Projekt vorbehaltlos unterstützen?
Auch der demokratische Aspekt darf nicht ausgeblendet werden. Der Bundesrat hat ein Vernehmlassungsverfahren zu einem Sachplan für die Cern-Projekte eingeleitet. Der Text unterliegt aber nicht dem Referendum. Bei einem Projekt dieser Grösse ist eine Entscheidung ohne öffentliche Debatte mehr als problematisch. Ich glaube an eine partizipative Wissenschaft, nicht an eine Planung im stillen Kämmerlein. Schliesslich geht es auch um Prioritäten. Die Wissenschaft braucht alle verfügbaren Mittel, um die dringlichen aktuellen Herausforderungen zu bewältigen: Klima, Gesellschaft und Wirtschaft. Die Erweiterung des Cern scheint dieses Ziel zu verfehlen. Und dies in einer Zeit, in der die Legitimität der Wissenschaft auf besorgniserregende Weise infrage gestellt wird. Denn sie wird nicht nur an grossen Leistungen gemessen, sondern auch daran, ob sie verstanden, geteilt und kollektiv getragen wird.
Meine Position ist keineswegs nur ideologisch, sondern sehr pragmatisch. Sie gründet auf der Vision einer Wissenschaft, die nicht vom Alltag der Menschen abgekoppelt ist, sondern die Bürgerinnen und Bürger, die Demokratie, die Biodiversität der Regionen und das Klima genauso respektiert wie die menschliche Neugier.
Delphine Klopfenstein Broggini ist grüne Nationalrätin aus Genf und engagiert sich seit einigen Jahren in Debatten um den Future Circular Collider.

Foto: ZVG
Als Teilchenphysikerin begeistert mich das Konzept des Future Circular Collider (FCC), denn er eröffnet neue Möglichkeiten, elementare Fragen über unser Universum zu erkunden. Die Grundlagenforschung basiert auf Neugier. Sie verfolgt keine unmittelbaren praktischen Anwendungen, sondern dient dazu, tiefergehende Erkenntnisse zu gewinnen. Oft führen gerade Entdeckungen, die zu Beginn keinen offensichtlichen Nutzen haben, später zu bedeutenden Fortschritten. Die Teilchenphysik, insbesondere die Forschung am Cern, liefert dafür zahlreiche Beispiele. Seien es Teilchenstrahlen zur Krebsbehandlung, Detektoren zur Bildgebung oder die Entwicklung des Internets.
Am Cern arbeiten Menschen aus der ganzen Welt. Sie entwickeln gemeinsam neue Experimente und Technologien. Es ist also auch ein Modell für erfolgreiche und friedliche internationale Zusammenarbeit. Und es trägt zum Ruf der Schweiz als Ort der Spitzenforschung entscheidend bei. Zudem ist es ein attraktiver Wirtschaftspartner: In Form von Aufträgen an die Industrie und an Dienstleister fliesst bis zum Dreifachen des jährlichen Beitrags der Schweiz an das Cern in das Land zurück. Daher ist der Bau des neuen Teilchenbeschleunigers auch ökonomisch interessant. Gleichzeitig bildet das Cern zusammen mit Universitäten und Forschungsinstituten die nächste Generation in verschiedensten Fachbereichen wie Physik, Ingenieurwesen oder Datenwissenschaften aus. Die Schweizer Wissenschaft profitiert stark davon.
Der FCC ist ein äusserst ambitioniertes Projekt – und das muss er auch sein, wenn er bahnbrechende Entdeckungen ermöglichen soll. Er bietet ein umfassendes und weltweit einzigartiges Physikprogramm. Derzeit ist Europa führend in der Teilchenforschung. Mit dem FCC würde das auch in den kommenden Jahrzehnten so bleiben. Dies stärkt die Idee von Fortschritt durch Zusammenarbeit, die in diesen Zeiten wichtig ist. Und so ziehen Europa und die Schweiz internationale Talente an, deren innovative Forschung uns allen zugutekommt.
Lea Caminada ist Gruppenleiterin Hochenergiephysik am Paul-Scherrer-Institut PSI und Professorin an der Universität Zürich. Sie forscht selbst am Cern.