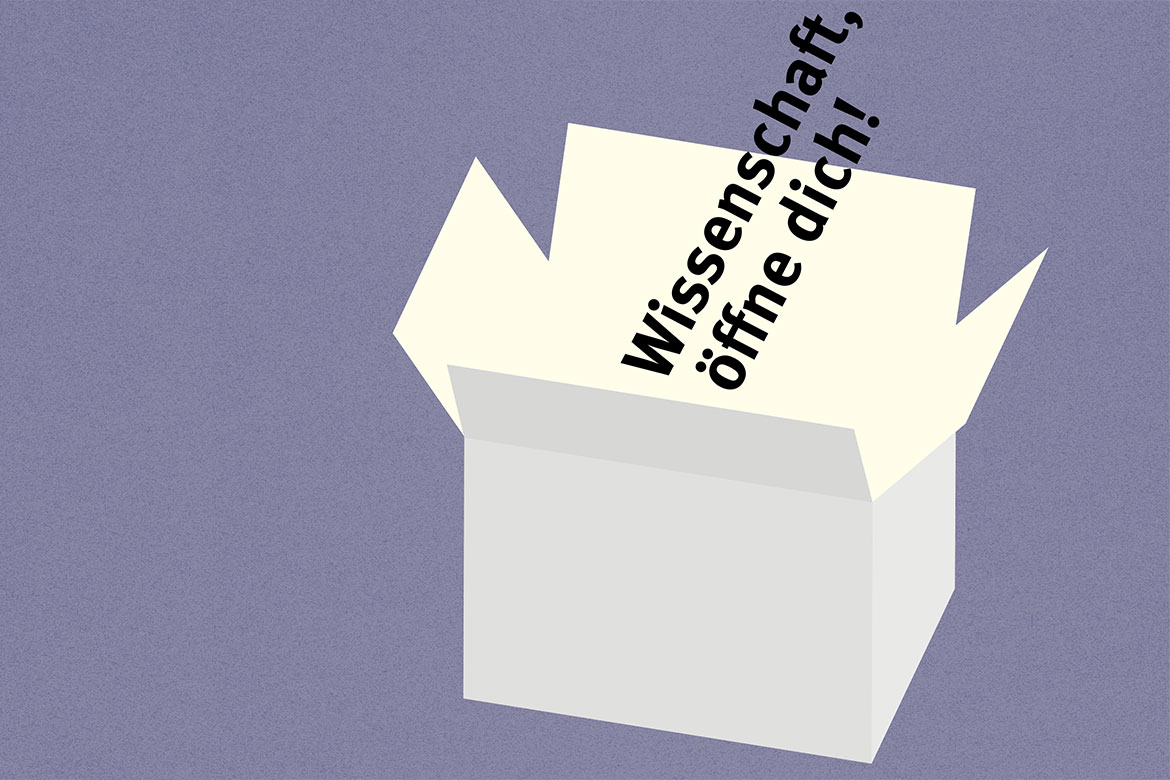PORTRÄT
Er zog mit Nietzsche durch die TV-Serien
Literaturwissenschaftler Stéphane Boutin hat Konflikte in amerikanischen Serien analysiert. Und die Menschen mit einem Essay über die eigene Erkrankung berührt. Von einem, der über alles intensiv nachdenkt.

Stéphane Boutin hat sich im Namen der Wissenschaft die Nächte mit den Sopranos, Mad Men oder Lost um die Ohren geschlagen. | Foto: Flavio Leone
Es ist selten, dass Texte von Forschenden eine breite Leserschaft betroffen machen und zu Leserbriefen motivieren. Stéphane Boutin ist dies im Mai 2024 mit einem persönlichen Es say in «Das Magazin» gelungen. In aller Offen heit erzählte er von seiner kurz zuvor dia gnostizierten Parkinsonkrankheit. Wie sie ihn und seinen Blick auf die Welt verändert.
Aber auch, was die Forschung heute über die Ursa chen von Parkinson weiss – und wo noch Lücken bestehen, wie zum Beispiel bezüglich des Einflusses von neurotoxischen Chemikalien in Pestiziden. «Ich erhielt Dutzende von E Mails», erinnert sich Boutin. Alte Schulfreunde haben ihm geschrieben, Nachbarinnen und Betroffene. «Die Rückmeldungen haben mir gezeigt, wie verbreitet Parkinson ist und wie oft diese Krankheit versteckt wird.»
Von Karl Mays Welt inspiriert
Boutin erreichte die Menschen auch, weil er zugänglich erzählen kann. In der Kindheit war es Karl May, der seine Faszination für das Schreiben weckte – auch wenn er den Exotis mus und Kolonialismus, der in dessen Büchern steckt, heute kritisch sieht. «May war ein Pionier des seriellen Erzählens.
In seinen Zyklen, wie demjenigen zum Orient, finden sich wiederkehrende Muster, die dafür sorgen, dass die Geschichte stetig weitergeht.» Später entdeckte er Stephen King, an der Kantons schule in Zürich Enge auch Max Frisch. Letz terer weckte sein Interesse für die Philosophie und trug dazu bei, dass er sich später an der Universität Zürich für ein Philosophiestudium einschrieb.
Dort besuchte er Vorlesungen von Elisabeth Bronfen. Die Professorin für englische und amerikanische Literatur beschäftigt sich auch mit Hollywoodfilmen und Serien wie Mad Men. «Sie zeigte uns, dass man auch Filme wie Bücher lesen und analysieren kann, sodass Motive und Strukturen zum Vorschein kommen», erzählt Boutin. Kurz zuvor waren in den USA eine Reihe von TVSerien produziert worden, wie etwa The Sopranos, die ein internationa les Millionenpublikum erreichten und bald zu einem kulturellen Phänomen wurden.
Für seine Dissertation analysierte Boutin schliesslich vier populäre USamerikanische TVSerien, die um die 2000er Jahre ausge strahlt wurden: The Sopranos, The West Wing, The Wire und Lost. «Jede Serie hat zwischen 60 und 100 Stunden Laufzeit; das war enorm viel Material!» Weil Boutin knapp zehn Jahre an seiner Dissertation arbeitete und sich der thematische Fokus über die Zeit verschob, musste er sich alle Staffeln gleich zweimal an schauen.
Massive Gewalt oder liberaler Diskurs
Neben seiner Arbeit als wissenschaft licher Assistent am Deutschen Seminar war das fast nicht zu schaffen. Deshalb verschrift lichte der Philosophiestudent seine Erkennt nisse während der Coronajahre 2020 und 2021, als er sich dank eines Stipendiums auf die Dissertation konzentrieren konnte. Abend für Abend schaute er sich ein bis zwei Episoden an, machte Notizen und schrieb seine Eindrü cke und Reflexionen am nächsten Tag nieder.
Boutin untersuchte, wie Konflikte in den Serien dargestellt werden, und arbeitete Typologien von deren Bearbeitung heraus. In The Sopranos zum Beispiel seien sie unausgesprochen und müssten mit massiver Gewalt immer wieder von Neuem zum Verschwinden gebracht werden, so Boutin. Ganz anders in The West Wing: Dort würden Uneinigkeiten in Diskursen domestiziert und unter den Prota gonistinnen und Protagonisten nach einem liberal demokratischen Ideal verhandelt.
Boutins zentraler Angelpunkt für die kultur theoretische und philosophische Analyse der TVSerien war das Werk von Friedrich Nietz sche, insbesondere sein agonales Konflikt modell. Agonale Strukturen bezeichnen das Spannungsverhältnis zwischen zwei gegensätzlichen Kräften, also zum Beispiel zwischen Figuren, die miteinander einen Streit austragen, oder zwischen gegensätzlichen Ideen. «Die Werke Nietzsches sind oft wie ein Labor, in dem er verschiedene agonale Muster aus probiert.»
So sieht Boutin zum Beispiel in Lost eine Erlösungserzählung, die ähnlichen Mustern folgt, wie er sie in Nietzsches Werk fand. «Diesen Bezug von Philosophie aus dem ausklingenden 19. Jahrhundert zu den Serien der 2000erJahre fand ich faszinierend.»
Überall Menschen mit Tremor
Heute hat Boutin ambivalente Gefühle, wenn er auf seine zehn Dissertationsjahre zurück schaut: Die vertiefte Auseinandersetzung mit Nietzsche, dem seriellen Erzählen und das Vermitteln von Wissen an eine nächste Gene ration als Assistent, das hält er in bester Er innerung. «Aber der Publikationsdruck, die Normalität, abends und an Wochenenden zu arbeiten, das alles liess sich schlecht mit einer neu gegründeten Familie vereinbaren.»
Zudem hat er erlebt, wie Freunde bereits vor Abschluss der Doktorarbeit komplett aus gebrannt waren. «Ich frage mich bis heute, ob die kompetitiven Mechanismen im Wis senschaftssystem wirklich qualitätsfördernd sind.» Boutin entschied sich deshalb bereits während der Dissertation, seine akademische Laufbahn nicht weiterzuführen. Heute arbei tet er als Studienprogrammkoordinator an der Universität Zürich.
Die Diagnose Parkinson erhielt Boutin erst nach der Promotion im Jahr 2023. «Wann die ersten Veränderungen begannen und ob der durch die Krankheit ausgelöste Dopaminmangel ein Faktor für meinen Entscheid war? Ich weiss es nicht.» Mit der chronischen Krankheit veränderte sich sein Blick auf die Gesellschaft. Überall sah er nun Menschen mit Tremor, dem für Parkinson typischen Zittern, oder solche, die sich merkwürdig langsam bewegen – ebenfalls eine Folge des Abbaus von Hirn zellen, dort, wo der Botenstoff Dopamin pro duziert wird.
Das Gesundheitssystem sei an den Bedürfnissen der «chronisch Gesunden» ausgerichtet. «Die regelmässigen Kosten für den Selbstbehalt bei den Medikamenten, die hohe Prämie für die tiefe Franchise, – das muss man sich alles leisten können.»
Freude am Kreativen und am Koordinieren
Stéphane Boutin wurde 1984 in Kilchberg (ZH) geboren und hat an der Universität Zürich Philosophie, deutsche Literaturwissenschaft und Politikwissenschaft studiert. Er doktorierte zu Krisennarrativen in TV-Serien und arbeitete gleichzeitig als wissenschaftlicher Assistent am Deutschen Seminar der Universität Zürich.
Boutin ist ein Musikliebhaber und arbeitete von 2004 bis 2014 als Texter, Projektmanager und Vorstandsmitglied beim Musiklabel kuenschtli.ch, wo er erstmals mit Social Media experimentierte. Von 2021 bis Mai 2025 war er Content-Manager für Instagram beim Nietzsche-Haus in Sils Maria. Seit Februar 2025 arbeitet er als Studienprogrammkoordinator für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft am Romanischen Seminar der Universität Zürich. Dort ist er unter anderem für Studienadministration und -beratung, Lehrplanung und Kommunikation zuständig. Er lebt mit Partnerin und Sohn in Zürich.
Kürzlich war Stéphane Boutin an einer Lesung des Südtiroler Dichters Oswald Egger. «Plötzlich, inmitten der Lesung, habe ich ge merkt, dass der Tremor verschwunden war, mein linkes Bein und die linke Hand waren auf einmal ganz ruhig», erinnert er sich. «Der Klang von poetischer Sprache kann offenbar Glücksgefühle erzeugen und entspannen.» Ähnliches erlebt er beim Klavierspielen und hören. Auch das tut ihm gut.
TV-Serien schaut er sich heute seltener an. «Das Nutzerverhalten wird nun beim Streaming in Echtzeit analysiert, und das Wissen darüber, wo die Leute abgeschaltet haben, fliesst in die nächste Staffel mit ein.»
Boutin erkennt darin eine Analogie zu Nietzsches Gleichnis der ewigen Wiederkunft: «Mit unserem alltäglichen Verhalten im Kleinen prägen wir die strukturellen Muster aus, in denen sich überindividuelle Prozesse auf Dauer etablieren. Oder eben: Grossflächig reproduziert wer den diejenigen Serien, die wir jeden Abend anklicken.» Kulturpessimist sei er deswegen nicht: Gerade durch die Klickökonomie habe sich das Angebot für manche Subkulturen deutlich erweitert: «Das ist eine positive Ent wicklung.» Damit ist zudem viel Stoff da, an dem sich eine Generation in Literatur und Kulturwissenschaft abarbeiten kann.