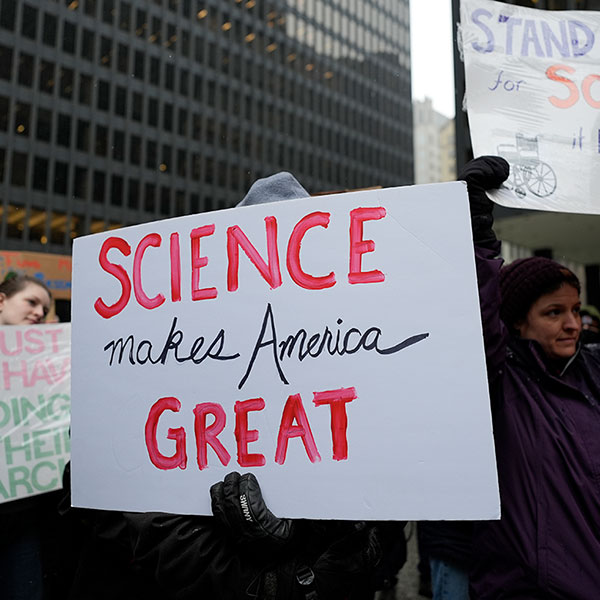REPRODUKTION
Auf dem Kinderwunschmarkt sind nicht alle gleich
Wie einfach eine Person Reproduktionstechniken in Anspruch nehmen kann, ist auch eine Frage dessen, ob sie der gesellschaftlichen Norm dafür entspricht. Und natürlich, ob sie Geld hat.

Der Weg zum Baby per künstlicher Befruchtung ist auch von Diskriminierung gesäumt. | Foto: Iacopo Pasqui / Connected Archives
Die Spermienqualität nimmt ab – und Frauen werden vermehrt erst später im Leben schwanger. In der Folge steigt das altersbedingte Risiko eines unerfüllten Kinderwunsches. In der Schweiz nehmen auch deshalb jedes Jahr zwischen 6000 und 7000 Paare medizinische Hilfe in Anspruch.
Dazu gehören die hormonelle Stimulierung des Eisprungs, die künstliche Insemination, bei der Samen in direkter Nähe der Eileiter platziert werden, Methoden der In-vitro-Fertilisation (IVF), dabei am häufigsten die sogenannte Intrazytoplasmatische Spermieninjektion, bei der ein einzelnes Spermium direkt in die Eizelle injiziert wird, sowie das Einfrieren von Samen und Eizellen.
Allein in der Schweiz bieten aktuell rund 30 Kinderwunschzentren diverse Reproduktionstechniken an, weltweit sind es Tausende. «Der Kinderwunsch ist zu einem florierenden Markt geworden», sagt Carolin Schurr, Professorin für Sozial- und Kulturgeografie an der Universität Bern.
«Es gibt heute transnationale Konsortien, die mit Sperma, Eizellen, IVF und reprogenetischen Technologien viel Geld verdienen.» Je nach Prognose wird der globale Fertilitätsmarkt bis 2030 ein Marktvolumen von 40 bis 80 Milliarden US-Dollar erreichen.
Eizellspende selten altruistisch
In der Schweiz ist die Fortpflanzungsmedizin im europäischen Vergleich streng reguliert: Neben der Leihmutterschaft ist auch die Eizellspende verboten. 2019 reisten deshalb über 500 Paare oder Einzelpersonen für Reproduktionstechniken ins Ausland. Dies geht aus einer Studie hervor, die Schurrs Gruppe in Zusammenarbeit mit dem Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung der Universität Bern durchgeführt hat.
Die Zahlen sind eine Annäherung. Die Autorinnen gehen von deutlich höherem Reproduktionstourismus aus. In gut 80 Prozent der Fälle war die Motivation eine Eizellspende. Meist verbunden mit einer Reise nach Spanien, das als führendes europäisches Reiseziel gilt.
Schurr kritisiert, dass in der öffentlichen Debatte zu Eizellspenden die Perspektive der Personen mit Kinderwunsch dominiere. Ihre Forschungsgruppe interessiert sich deshalb für die Erfahrungen der Spenderinnen und hat in Spanien 30 von ihnen befragt. «Die altruistische Spende ist eine Illusion», sagt Carolin Schurr. «Die Eizellspende erfolgt praktisch immer aus ökonomischen Gründen.» Unter den Befragten befanden sich armutsbetroffene Frauen, aber auch solche aus der Mittelschicht, die das Geld nutzten, um sich das Studium zu finanzieren oder um für ein hilfsbedürftiges Familienmitglied aufzukommen.
In Spanien erhalten Eizellspenderinnen keinen Lohn, sondern eine Entschädigung von rund 1000 Euro pro Eizellspende. «Manche hatten sich bis zu 20-mal Eizellen entnehmen lassen», erzählt Schurr. «Für sie war es schlicht ein Job.» Ein äusserst riskanter Job, denn laut einem Gutachten der deutschen NGO Genethisches Netzwerk kann die Eizellspende zum lebensbedrohlichen ovariellen Überstimulationssyndrom, zu Unfruchtbarkeit und zu psychosozialen Belastungen führen.
Der Begriff der Spende folgt laut Schurr auch dem Geschlechterstereotyp, dass Frauen reproduktive Leistungen aus Liebe erbringen. «Ärztinnen und Laboranten verdienen daran. Weshalb Spenderinnen nicht?» Viele Feministinnen lehnen die Eizellspende heute kategorisch ab. Prekarisierte Personen aus Süd- und Osteuropa sowie aus dem globalen Süden würden für die reproduktiven Wünsche von Reichen ausgebeutet, so die Argumentation. Derzeit wird auch in der Schweiz diskutiert, wie eine gerechte Eizellspende aussehen könnte. Der Bund hat auf die zunehmende Nachfrage reagiert und Ende Januar die Eckwerte für eine Zulassung ab 2026 beschlossen.
Zu arm zum Verhüten
Sozialforschende interessieren sich schon lange für Gerechtigkeitsfragen beim Kinderkriegen, bei Verhütung und Abtreibung – für sie alles Facetten desselben Themenkomplexes. In den 90er-Jahren entwickelten afroamerikanische Frauen in den USA das aktivistische Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit. Ob Frauen über ihren eigenen Körper bestimmen und frei entscheiden können, ob sie ein Kind gebären – oder nicht –, hänge auch von sozioökonomischen Faktoren und vom Zugang zu Ressourcen ab, argumentierten sie.
Schurr bezieht sich in ihrer aktuellen Forschung darauf. Mit einem achtköpfigen Team geht sie den Fragen nach, wie Reproduktion politisch gezielt gesteuert wird und wessen Reproduktion erwünscht ist und wem sie verwehrt wird.
Solche Ungleichheiten zeigen sich exemplarisch im Teilprojekt der Sozialanthropologin Milena Wegelin von der Berner Fachhochschule, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Laura Perler zur Situation von schwangeren Frauen in Asylunterkünften forscht. Sie hat dafür Interviews mit arabischsprachigen Frauen im Kanton Bern geführt. Trotz anfänglichem Kinderwunsch würden sich viele nach Ankunft in den Asylunterkünften gegen eine Schwangerschaft entscheiden. «Die Situation für Schwangere ist besonders in den Bundesasylzentren prekär. Viele essen zu wenig, weil sie keine Möglichkeit haben, den durch die Schwangerschaft veränderten Ernährungsbedürfnissen nachzugehen und selbst zu kochen.»
Zudem fehle es zuweilen an Wochenbetten und Stillräumen. «Gleichzeitig ist es für die Frauen auch schwierig, nicht schwanger zu werden, weil sie oft keinen Zugang zu Verhütungsmitteln haben.» Das Sozialhilfegeld etwa reicht nicht aus, um die Pille zu kaufen. Die paradoxe Situation: Asylsuchende werden in den kollektiven Unterkünften entweder ungewollt schwanger, oder eine Schwangerschaft unter angemessenen Bedingungen bleibt ihnen verwehrt. Gleichzeitig geben Schweizerinnen viel Geld aus, um sich im Ausland ihren Kinderwunsch zu erfüllen.
Gemäss Nicole Bourbonnais haben Ungerechtigkeiten im Bereich der Fortpflanzung eine lange Geschichte. Die kanadische Historikerin, die am IHEID Genf forscht, hat im Frühling ein Buch über die Reproduktionspolitik im 20. Jahrhundert veröffentlicht. «Mit eugenischen Politiken wurden Zwangssterilisationen zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einer Reihe von Ländern gefördert, genauso wie Jahrzehnte später auch Programme zur Bevölkerungskontrolle», resümiert sie.
Bis heute gebe es Fälle von Zwangssterilisationen, wobei sich diese meist gegen marginalisierte Gruppen, ethnische Minderheiten, Armutsbetroffene und Menschen mit Behinderungen richteten. «Die in der Gesellschaft dominierenden Gruppen werden oft zur Fortpflanzung ermutigt, während Minderheiten entweder unter Druck gesetzt oder bewusst daran gehindert werden», so Bourbonnais. Bis 2017 galt das in der Schweiz auch für Transpersonen. Biologische Frauen mussten sich während einer operativen Geschlechtsangleichung sterilisieren lassen, damit ihr neues Geschlecht amtlich anerkannt wurde.
Schweiz ist europäisches Schlusslicht
«Die Gesellschaft wollte um jeden Preis verhindern, dass es schwangere Männer oder zeugende Frauen gibt», sagt Tanja Krones, leitende Ärztin Klinische Ethik am Universitätsspital Zürich. Zudem sei die Mehrheitsgesellschaft blind davon ausgegangen, dass Transpersonen keine Kinder wollen. «Eine ganze Generation hatte aufgrund der Zwangssterilisierungen gar nie die Möglichkeit, sich zu reproduzieren», sagt Krones. Erst durch einen Entscheid des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Jahr 2017 wurden die Zwangssterilisierungen auch in der Schweiz aufgehoben.
Krones ist aktuell Co-Direktorin des Forschungsschwerpunkts «Human Reproduction Reloaded» an der Universität Zürich. Im Fokus stehen medizinische Technologien zur menschlichen Fortpflanzung und deren soziologische, ethische und rechtliche Auswirkungen. Eine 2024 gegründete Interessengruppe für Transgender und Gender Diversity wird zudem Forschung auf diesem Gebiet bündeln. Das erarbeitete Wissen soll später in die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten fliessen.
Die Schweiz habe bezüglich reproduktiver Gerechtigkeit noch grossen Nachholbedarf, sagt Krones. So sei zum Beispiel die ungewollte Kinderlosigkeit laut Weltgesundheitsorganisation nach einem Jahr des ungeschützten Geschlechtsverkehrs ein Krankheitszustand. Sie empfehle deshalb, dass Staaten die IVF als Teil der reproduktiven Gesundheit behandeln.
Viele europäische Staaten, darunter Frankreich, Belgien, Schweden und Dänemark, übernehmen die Kosten bereits vollumfänglich, meist auch für lesbische Paare und alleinstehende Frauen. Nicht so in der Schweiz. Das sei ungerecht, findet Krones. «Zwangsläufig stellt sich die Frage: Wer kann es sich in der Schweiz überhaupt leisten, Kinder zu kriegen?» Die Forschung zeigt: Der weltweite Reproduktionsmarkt strotz vor Ungerechtigkeiten.